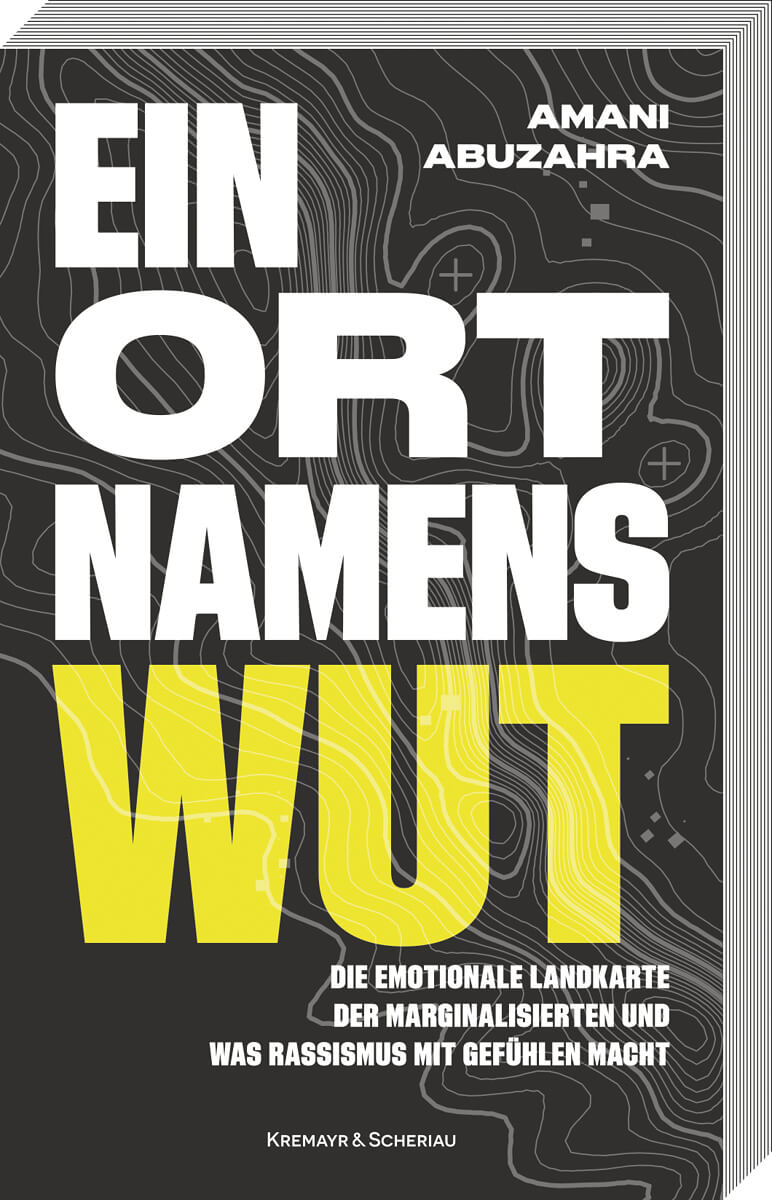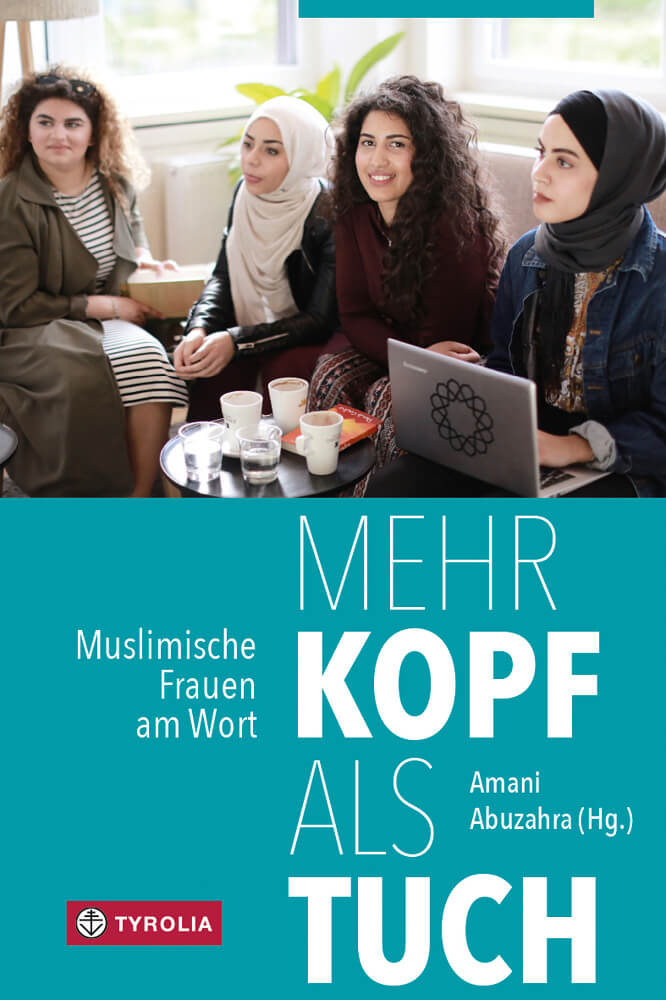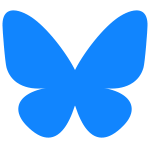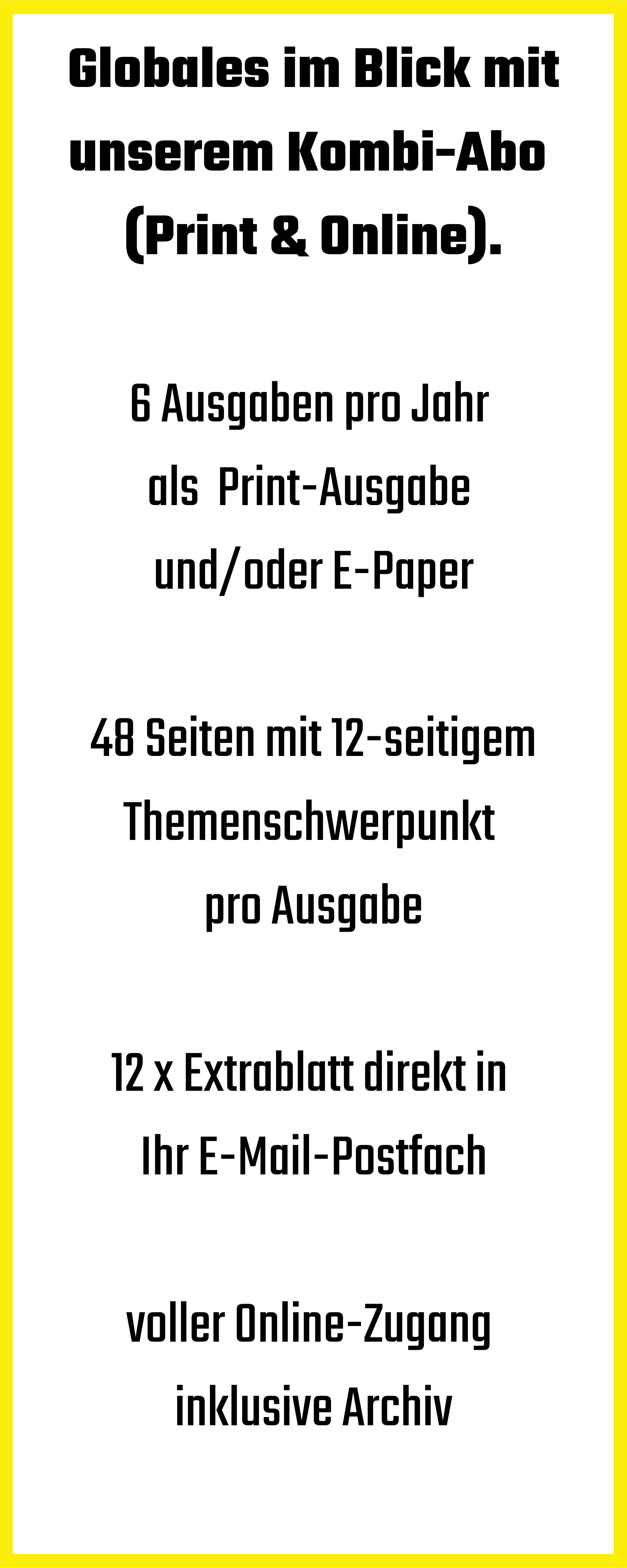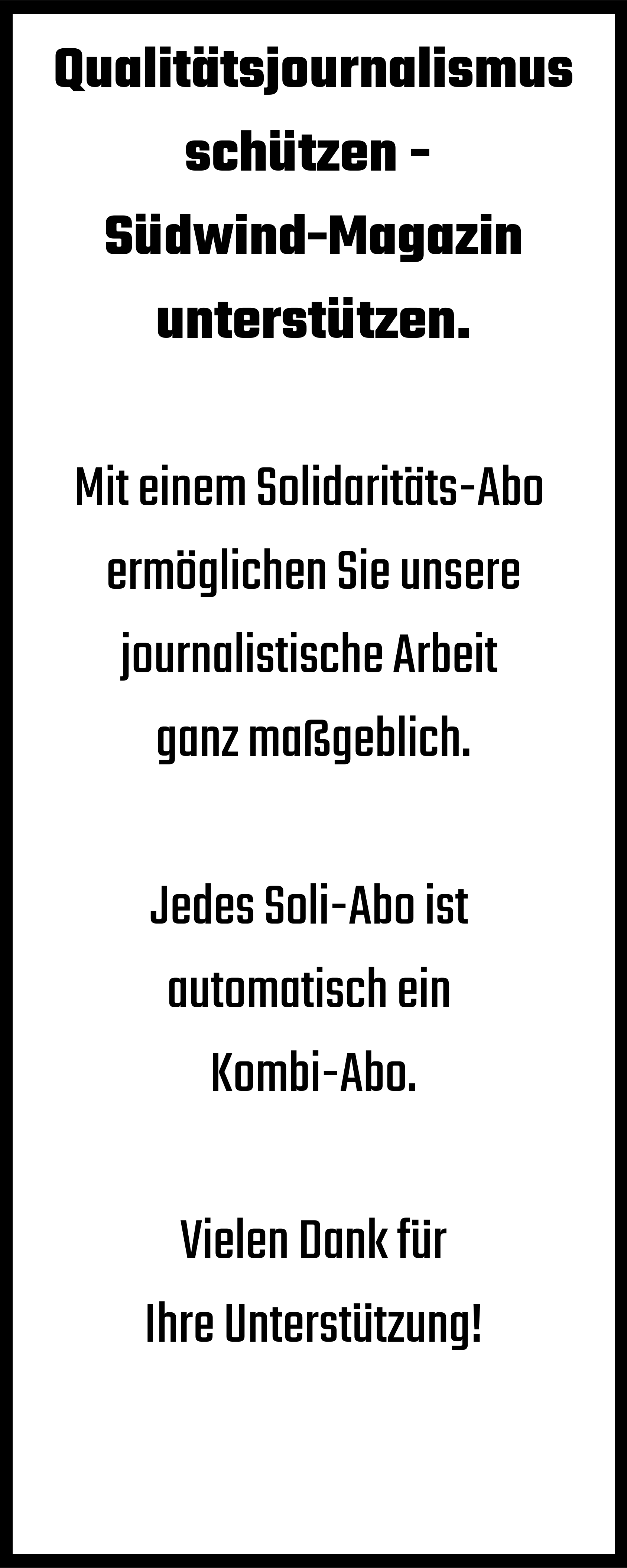Österreich steht an der Spitze der EU, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht. Amani Abuzahra, Philosophin und Buchautorin, spricht im Interview über konstruierte Feindbilder, das Loslassen von Vorurteilen und Begegnungen auf Herzensebene.
Sie arbeiten zum Thema antimuslimischer Rassismus in Österreich. Was fühlen Sie angesichts der politischen Geschehnisse 2025?
Es geht Schlag auf Schlag in Österreichs Innenpolitik. Bereits zu Jahresbeginn hat sich die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für einen „Kampf gegen den Islam“ ausgesprochen und der ORF hat diese Aussage unkommentiert gesendet. Als Muslimin fühle ich mich davon betroffen. Mikl-Leitner hat dann zwar ein vermeintlich aufklärendes Statement nachgeschickt, wonach sie „selbstverständlich den politischen Islam“ gemeint hätte. Das war aber keine Entschuldigung, sondern fühlte sich wie eine weitere Ohrfeige an. Auf gesellschaftlicher Ebene empfinde ich das als brandgefährlich. Solche wiederholten Aussagen geben den Leuten grünes Licht für antimuslimischen Rassismus – und werfen uns um Jahre zurück in dem, was wir bereits erreicht zu haben glaubten.
Worauf beziehen Sie sich da konkret?
Die Wahlergebnisse zeigen es: Populistische Politiker:innen kommen mit ihren auf den Islam reduzierten Feindbildern an. Bei der Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus sind in den Jahren 2023 und 2022 die Fallmeldungen stark gestiegen: Um über 100 Prozent, auffällig oft kommen sie aus dem Bildungsbereich.
In der Wirtschaft zeigt man sich pragmatischer, oft aus neoliberalen Gründen. Dort findet man diverse Bevölkerungsgruppen interessant, sowohl als Kund:innen als auch als Personal. Man will ihren Zugang zu Communities, ihre sprachlichen und sozialen Kompetenzen, ihre Energie und ihr Potenzial nutzen. Neulich habe ich in einer Werbung aus der Baubranche eine Frau mit Kopftuch entdeckt.
Und was fühlen Sie angesichts dessen? Welche Emotion steht im Vordergrund?
Es tut weh und ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel Energie aufwenden müssen, um das Ruder herumzureißen. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, vor allem nicht im Bildungsbereich, denn es werden wieder neue Generationen kommen, die anders sein können. Und gleichzeitig gibt es gerade jetzt wieder eine starke von Solidarität getragene Bewegung. Viele Menschen, auch Nichtmuslime, haben das Bedürfnis zu zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind, dass sie sich empören. Das gibt Kraft, Empowerment, ja sogar Zuversicht!
Gerade konservative Politiker:innen werden nicht müde, sich auf eine österreichische Identität, Werte und Traditionen zu berufen. Wie und wo sehen Sie denn eine österreichische Identität?
Für mich ist es etwas, das schwer festzumachen ist und sich ständig verändert. Jede:r versteht etwas anderes darunter. Allein was die österreichische Sprache betrifft – und darauf beziehen sich doch so viele! Da gibt es zahlreiche Dialekte und dementsprechende Vorstellungen von Heimat. Ich komme aus Niederösterreich und war in Oberösterreich im Internat, jetzt lebe ich in Wien – und Deutsche haben mir neulich gesagt, ich klinge wienerisch. Früher sagte man in Österreich „passt“, heute sagt die jüngere Hälfte der Bevölkerung das, was ich als Bundesdeutsch empfinde: „alles gut!“. Diese Veränderungen eröffnen Möglichkeiten. Eigentlich sollte das positiv sein.
Eigentlich?
Österreichische Identität wird von vielen Politiker:innen als etwas Abgrenzendes genutzt. Und zwar nicht um sich selbst zu spüren, sondern abwertend, um besser dazustehen. Das Feindbild Islam zum Beispiel wird seit der Türkenbelagerung mit negativen Assoziationen aufgeladen und so lange wiederholt bis es in den Köpfen fest verankert ist. Dabei ist Österreichs Geschichte, die Zeit der Monarchie, von multiethnischer Vielfalt geprägt. Dieser Aspekt wird aber nicht erzählt, sondern ausgespart. Das verstellt den Menschen den Weg zu einem friedlichen und interessanten Zusammenleben.
In Ihrem Buch „Ein Ort namens Wut“ schreiben Sie darüber, dass nicht allen Menschen zugestanden wird, sich in der öffentlichen Sphäre zu dieser Emotion zu bekennen. Wutbürger:innen werden anders gesehen und gehandelt, als Menschen, die von der Mehrheitsgesellschaft marginalisiert werden. Worauf begründet sich denn diese Wut?
Es gibt diejenigen, die auf einer wirtschaftlichen Ebene abgehängt wurden, die dadurch Sicherheit verloren haben oder zumindest davor Angst haben. Und dann gibt es Menschen, die wirtschaftlich abgesichert sind, das aber gar nicht so wahrnehmen. Das ruft dann in vielen das Gefühl hervor, es anderen nicht zu gönnen, auch in Sicherheit leben zu können. Wenn die Politik wirtschaftliche Probleme nicht für alle lösen kann, dann kann sie über Feindbilder – Stichwort Kopftuchdebatte – davon ablenken und auf emotionaler Ebene Neid und Hass schüren. Das funktioniert leider immer wieder.
Sie leiten Workshops zu antimuslimischem Rassismus für ganz unterschiedliche Gruppen, u. a. Beamt:innen. Wie führen Sie die Menschen an dieses sensible Thema heran?
Ganz langsam. Kaum wer bezeichnet sich selbst als rassistisch. In den Workshops geht es auch gar nicht darum, die Leute als rassistisch hinzustellen. Ich habe gelernt, dass die meisten Menschen gerne lernen, also reflektieren wir zuerst gemeinsam, was sie wissen. Ich verweise auf einschlägige Studien, etwa von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte oder dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Je mehr sie erfahren, desto aufnahmewilliger werden sie. In einer offenen Atmosphäre gehen wir dann – auch mithilfe von physischer Bewegung – in (Selbst-)Reflexionsübungen. Später überprüfen wir die eigenen Privilegien und spüren Vorurteile auf. Erst dann kann es gelingen, diese loszulassen, sich von Trennendem zu befreien und es im Idealfall gegen etwas einzutauschen, was uns verbindet.
Eine Frage an Sie als Philosophin: Welche Strömung oder Schule erscheint Ihnen heute wichtig, um polarisierende Tendenzen in der Gesellschaft aufzuhalten oder umzukehren?
Die Schule der Dekonstruktion. Es sollte heute nicht mehr nur darum gehen, neues Wissen zu generieren, sondern vielmehr darum, tradierte, gesellschaftliche Machtverhältnisse in Frage zu stellen. Wir können dabei an Legobausätze denken: Wir zerlegen sie, nicht um die einzelnen Steine dann wegzuwerfen, sondern um damit neue Strukturen zu schaffen. Auf der gesellschaftlichen Ebene geht es auch darum, neue Menschen einzubeziehen, zu inkludieren. Wichtig dabei ist, so denke ich mit dem deutschen Arabisten Thomas Bauer, auch Widersprüchliches zuzulassen, was innerhalb herkömmlicher Normvorstellungen keinen Platz bekommen hat. Es sollte okay sein, wenn andere anders leben, lieben oder glauben als wir. Und es würde uns auch helfen, wenn wir uns selbst wieder mehr von diesem Widersprüchlichen erlauben würden. Bauer nennt das „die kulturelle Ambiguitätstoleranz erhöhen“. Im Arabischen gibt es dafür übrigens viele Begriffe, weil diese Nichteindeutigkeit viel akzeptierter ist.
Und ganz konkret: Wie können wir als Gesellschaft lernen, zu- und aufeinander zu schauen?
Wir sollten uns darin üben, ungerechte Strukturen wahrzunehmen: Ob Rassismus, Klassismus, Sexismus, es gibt viel zu erkennen. Nachdem ich über die Wut geschrieben habe, habe ich gelernt, wie viele Menschen – vor allem marginalisierte – sich nicht erlauben, Wut zu empfinden, geschweige denn, sie auszudrücken. Wir lernen, dass Wut etwas Negatives ist. Dabei ist es ein ermächtigendes Gefühl, das Energie gibt, auf Grenzüberschreitungen und Ungerechtigkeiten zu reagieren! Das sollten wir uns und anderen zugestehen. Und wir sollten uns unserer Privilegien bewusst werden, um aus dieser Position heraus – so gut wir es halt können – jene zu unterstützen, die sie nicht haben.
Aber was antworten Sie jenen, die sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind, und sich stattdessen diskriminiert fühlen: Wegen ihres Alters, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts?
Vielleicht gibt es diese Art der Verallgemeinerung, nach dem Motto „es geht eh allen schlecht“, besonders oft in Österreich. Studien zufolge hält Österreich den traurigen ersten Rang unter 16 EU-Ländern, was antimuslimischen Rassismus betrifft. Ich antworte darauf mit konkreten Fragen, die zeigen, wie sich Diskriminierung manifestiert. Etwa, wie viel größer die Chance für einen weißen Mann ist, eine bestimmte Wohnung zu bekommen, als für eine Schwarze Frau. Wichtig ist dabei, aber auch nicht nur auf der kognitiven Ebene zu bleiben, sondern auch die emotionale, die Herzensebene zu berühren. Und das funktioniert am besten durch ganz reale Begegnungen mit den vermeintlich Anderen.
Und wie klappt das im wirklichen Leben?
Das ist das Problem. Begegnungen zu schaffen wäre auch Aufgabe der Politik. Leider fördert sie das zu wenig und verhindert zu viel! Deswegen müssen wir uns alle, jede und jeder hier, darum kümmern. Uns weiterbilden, solidarisch sein und handeln, unser Wahlrecht auf allen Ebenen nutzen und uns nicht vor Begegnungen scheuen: weder mit Andersdenken, noch mit unseren eigenen Vorurteilen und Emotionen! Wut und Mut tun gut.
Interview: Christina Schröder

Amani Abuzahra ist promovierte Philosophin, Autorin und Public Speakerin. Sie ist Referentin zum Thema antimuslimischer Rassismus, Islam und Interkulturalität in Österreich. 2019 wurde sie mit dem „25 Frauen Award“ (Edition F/Die Zeit) in der Kategorie Frauen, die mit ihrer Stimme die Gesellschaft verändern, ausgezeichnet. Aktuell forscht sie an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.
Buchtipps
Amani Abuzahra
Ein Ort namens Wut
Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 2023, € 25
Amani Abuzahra (Hsg.)
Mehr Kopf als Tuch.
Muslimische Frauen am Wort
Tyrolia, Innsbruck 2017, € 18
Black Voices
War das jetzt rassistisch?
Leykam Verlag, Graz 2022, 224 Seiten, € 23,50
Thomas Bauer
Die Kultur der Ambiguität
Suhrkamp, Berlin 2011, € 37,10
Thomas Bauer
Die Vereindeutigung der Welt
Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt
Reclam, Stuttgart 2018, € 7,95