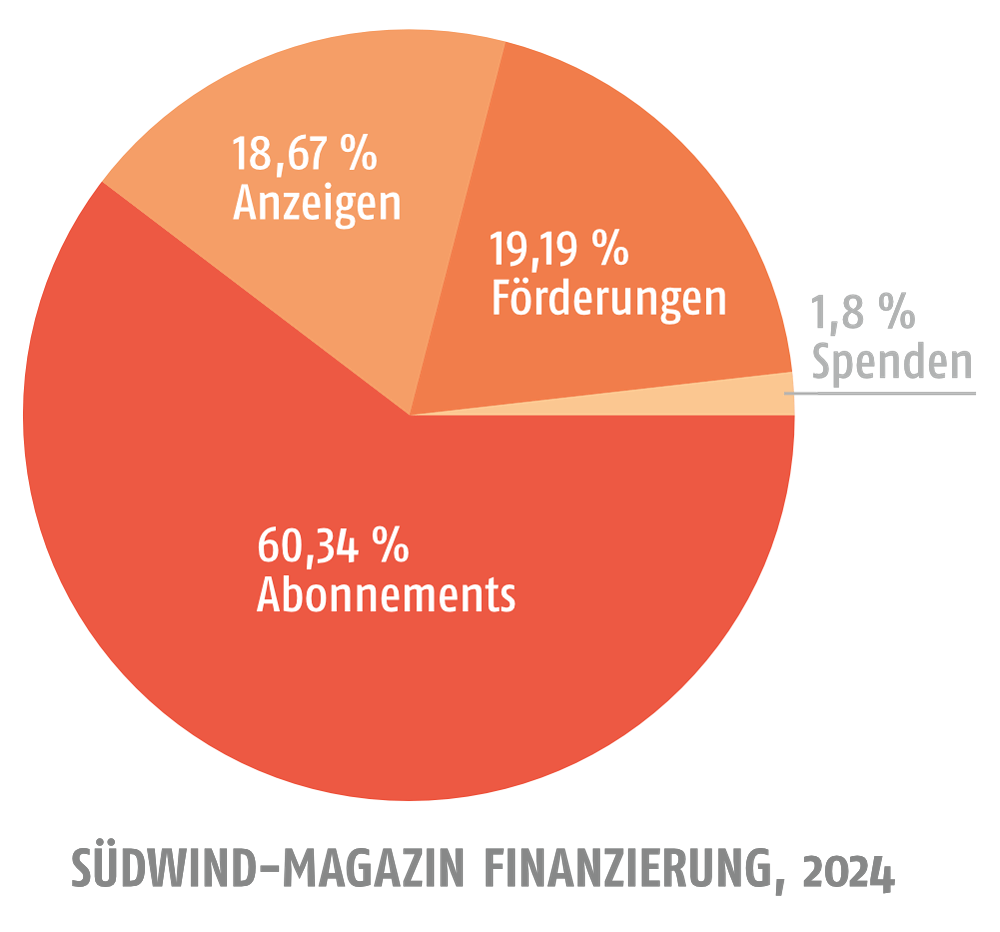Was es heißt, in einem Land, wo nichts funktioniert, eine Institution zu betreiben, weiß Ferel Bruno von der Organisation „Unsere kleinen Brüder und Schwestern“. Diese betreibt in in neun lateinamerikanischen und karibischen Ländern Waisenhäuser. Haiti ist das ärmste dieser Länder und derzeit wohl auch das gefährlichste.
Ein gescheiterter Staat? Ferel Bruno überlegt kurz: „Nein, als gescheiterten Staat würde ich Haiti noch nicht bezeichnen.“ Der Leiter des Waisenhauses „Unsere kleinen Brüder und Schwestern“ in Kenskoff zeichnet allerdings kein sehr optimistisches Bild des Karibikstaates. Kenskoff liegt 1.700 Meter über dem Meer. Von der Hauptstadt Port-au-Prince ist es eine mühsame und kurvenreiche Fahrt auf die Anhöhe, von der man Richtung Süden wie Richtung Norden den Ozean sehen kann. Zu Mittag. Denn morgens blickt man auf dichten Nebel oder eine Wolkenbank hinab. Über den Wolken – das trifft auf das Waisenhaus Ste. Hélène und das gleich daneben errichtete neue Spital auch in anderer Hinsicht zu. Man ist hier weit entfernt von der tristen Wirklichkeit des bankrotten Landes.
Wie kaputt das Land ist, kann man nicht übersehen, wenn man nur die Straße nach Kenskoff hinauf fährt. „Die letzten zwei Kilometer habe ich richten lassen“, sagt Bruno: „Mit Zement, denn der Asphalt hält nicht lange genug.“ Und auch die Stromversorgung muss er selbst organisieren. „Elektrischer Strom?“ Da lacht er: „Wir müssen zwar viel zahlen, haben aber fast nie Licht. Manchmal bleibt es zwei Wochen überhaupt finster.“ Wenn einmal für ein paar Stunden Strom aus der Steckdose kommt, dann werden die 16 Autobatterien aufgeladen, die die Stromversorgung garantieren. Die Solarzellen auf dem Dach helfen auch mit. Und wenn alle anderen Quellen versagen, gibt es immer noch den Dieselgenerator. „Wir haben alle Systeme, die Sie sich vorstellen können.“ Damit ist das neue Spital besser dran als das Allgemeine Krankenhaus in Port-au-Prince. „Dort fällt manchmal der Strom während einer Operation aus.“
Rund 400 Kinder leben im Waisenhaus der „Kleinen Brüder und Schwestern“. Dazu noch 26 behinderte Kinder, die mangels geeigneter Einrichtungen ihr ganzes Leben hier verbringen werden. Wer im Heim die Schule absolviert, verpflichtet sich, anschließend ein soziales Jahr abzuleisten: sei es in der Kinderbetreuung, als Bäcker oder in einem anderen Arbeitsbereich. Manche können noch während der Ausbildung ein Praktikum in irgendeinem Betrieb machen und werden dann auch angestellt. Das ist aber keine Jobgarantie. Denn viele Kleinunternehmen müssen aufgeben. „Einer ging in Konkurs, weil der Chef gekidnappt wurde“, erzählt Ferel Bruno. Das Lösegeld wurde bezahlt und dann war kein Betriebskapital mehr da.
Ferel Bruno liest kaum Zeitungen und hört keine Nachrichten. Präsident René Préval bemühe sich, meint er. Aber er bekomme das versprochene Geld von der internationalen Gemeinschaft nicht. Eine Rückkehr des von den USA ins Exil expedierten Ex-Präsidenten Aristide hält Bruno nicht für förderlich. Dessen Anhänger haben sich zu kriminellen Banden zusammengeschlossen, die ganze Stadtteile terrorisieren. Nach Port-au-Prince fährt Bruno daher ungern und nie ohne Begleitung: „Wer Geld hat oder für eine Institution mit ausländischer Finanzierung arbeitet“, wird leicht verschleppt. Besonders Cité Soleil, der ärmste Stadtteil, eigentlich ein riesiger Slum am Hafen, wird von rivalisierenden Gangs beherrscht, die sich durch Kidnapping finanzieren.
www.nphamigos.org