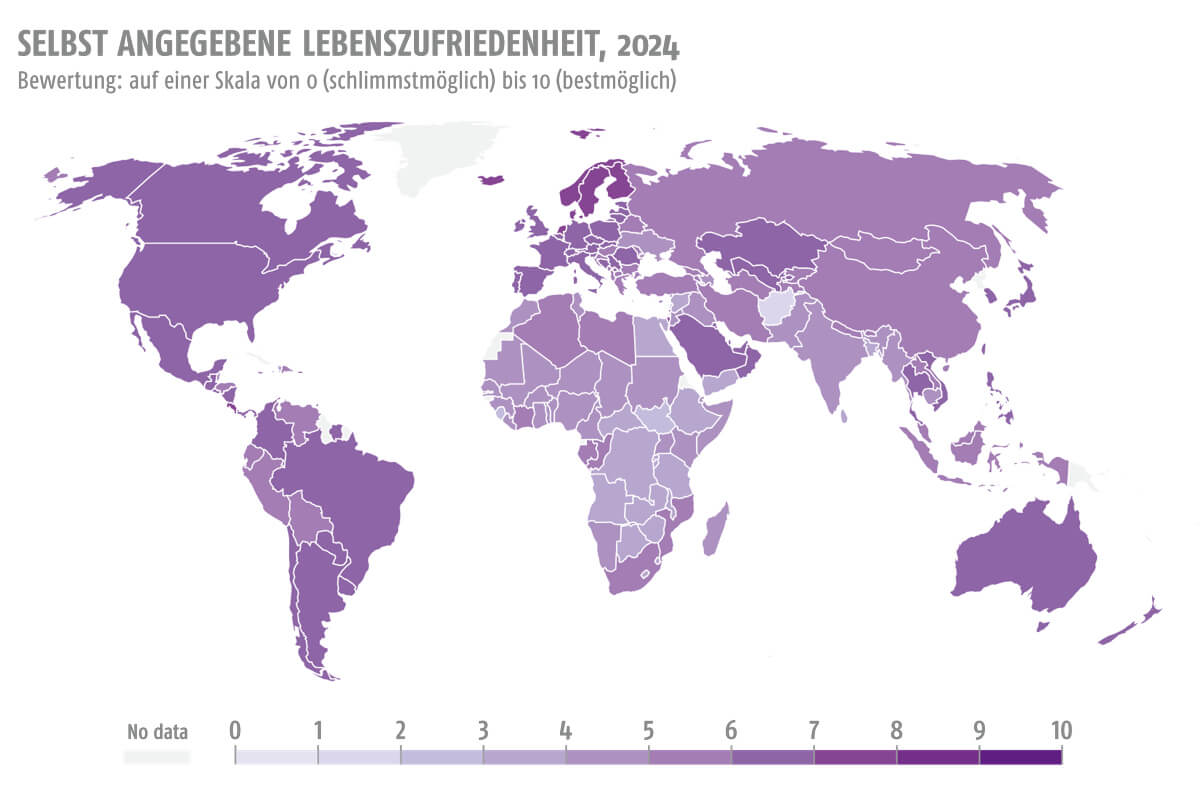
Vorsicht, Markt: Bitte nicht stören
Der IWF propagiert neuerlich ein Ausgleichsverfahren für staatliche Schuldner, doch die Finanzwelt sieht kaum Bedarf: Trotz Krisen lief das Geschäft bisher blendend.
Letzteres ist essenziell, denn seit der steigenden Bedeutung von Anleihen in der Schuldenstruktur von Schwellenländern („Emerging Markets“ – EM; inklusive Südkorea) hat man es nicht mehr bloß mit wenigen Banken, sondern mit einer großen Zahl von Gläubigern zu tun – und auch mit so genannten „Vulture Funds“, die Schuldtitel am Sekundärmarkt billig erwerben und dann vor den zuständigen Gerichten (je nach Anleihenbestimmungen) auf volle Bezahlung klagen. Ein Beispiel war Elliott Associates LP, der die peruanische Regierung im Oktober 2000 nach einem vierjährigen Rechtsstreit zu einem Vergleich zwang, der Lima 58 Mio. US-Dollar kostete. Elliott Associates sackte einen Gewinn von rund 47 Mio. Dollar ein.
Ein Ausgleichsverfahren würde eine wesentliche Schwäche des internationalen Finanzsystems beseitigen, bekräftigte die Vizechefin des IWF, Anne Krueger, bei der Präsentation der gegenüber November leicht veränderten Variante. Die Rolle des IWF soll sich nun auf eine vorläufige Zustimmung zu einem Zahlungsaufschub beschränken, den ein Schuldnerland von sich aus fordert; die Verhandlungen würden vor einem unabhängigen Schiedsgericht geführt. Eine „Supermajority“ (60-75%) der Gläubiger sollte dann eine für alle verpflichtende Umschuldung beschließen können. Der einfachste Weg dorthin wäre eine Veränderung der IWF-Statuten, die unter anderem 85% der Stimmrechte der IWF-Aktionäre erfordert – ohne USA (17,16%) geht also nichts.
Kaum hatte Krueger das neue Konzept vorgetragen, kam das Njet aus dem US-Finanzministerium. Zwar waren kurz darauf wieder gegenteilige Töne zu hören, doch schließlich meldete sich das Institute of International Finance (IIF) zu Wort, ein 1983 im Rahmen der Schuldenkrise gegründeter Weltverband der Finanzinstitutionen, und erteilte dem Konzept ebenfalls eine Absage. Das IIF bevorzugt, ähnlich wie das US-Finanzministerium, freiwillige, „markt-basierende“ Verfahren, während die Einbindung aller Gläubiger in Umschuldungen durch so genannte „Collective Action“-Klauseln in Anleihenverträgen und rechtliche Schritte gegen „Vulture Funds“ erreicht werden soll. Bestehende Anleihen ohne derartige Klauseln sollten durch entsprechende Anreize in neue Anleihen „geswapt“ werden.
Ein Grund für diese Abneigung gegen ein gesetzliches Verfahren ist klar: Es würde die Schuldnerseite begünstigen, was allerdings nur eine Korrektur der gegenwärtigen asymmetrischen Machtverteilung auf den internationalen Kapitalmärkten wäre. Denn aufgrund ihrer Abhängigkeit von Auslandskapital lassen sich viele Regierungen lieber IWF-Programme einreden, als mit noch höheren Zinsen oder überhaupt der Aussperrung aus den Kapitalmärkten konfrontiert zu sein.
Einen Beweis für diese Asymmetrie liefern die letzten „freiwilligen“ Umschuldungen mit Regierungen, ob mit Pakistan (1999), der Ukraine (April 2000) oder Ecuador (August 1999). Letztlich profitierten in jedem Fall vor allem die Gläubiger, sagt die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) in einer Analyse. Ein weiterer Beweis ist das „Business as usual“: Das Länderrisiko bzw. der Zinsaufschlag (Risikoprämie) ist selbst ohne „An-steckungseffekt“ systematisch überhöht, wie der Generalsekretär der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL), José Antonio Ocampo betont. Nicht nur bezahlen die Schuldner zu viel, die Risikoprämien werden selbst zur Krisenursache, wie Argentinien gezeigt hat.
Umgekehrt, für die AnlegerInnen, ist das Geschäft mit EM-Anleihen aber durchaus einträglich, und zwar trotz der Finanzkrisen der letzten Jahre, wie der steigende Marktindex von J.P. Morgan zeigt (siehe Grafik). Ohne Argentinien stieg der Index 2001 um 20%. Und das ist nur der Richtwert. Der beste unter 30 in Österreich registrierten EM-Anleihenfonds etwa erzielte in den letzten drei Jahren eine Rendite von fast 140%, und wer in russische Anleihen investierte, brachte es allein 2001 auf 60%. Anders gesagt: Worin besteht das Problem?






