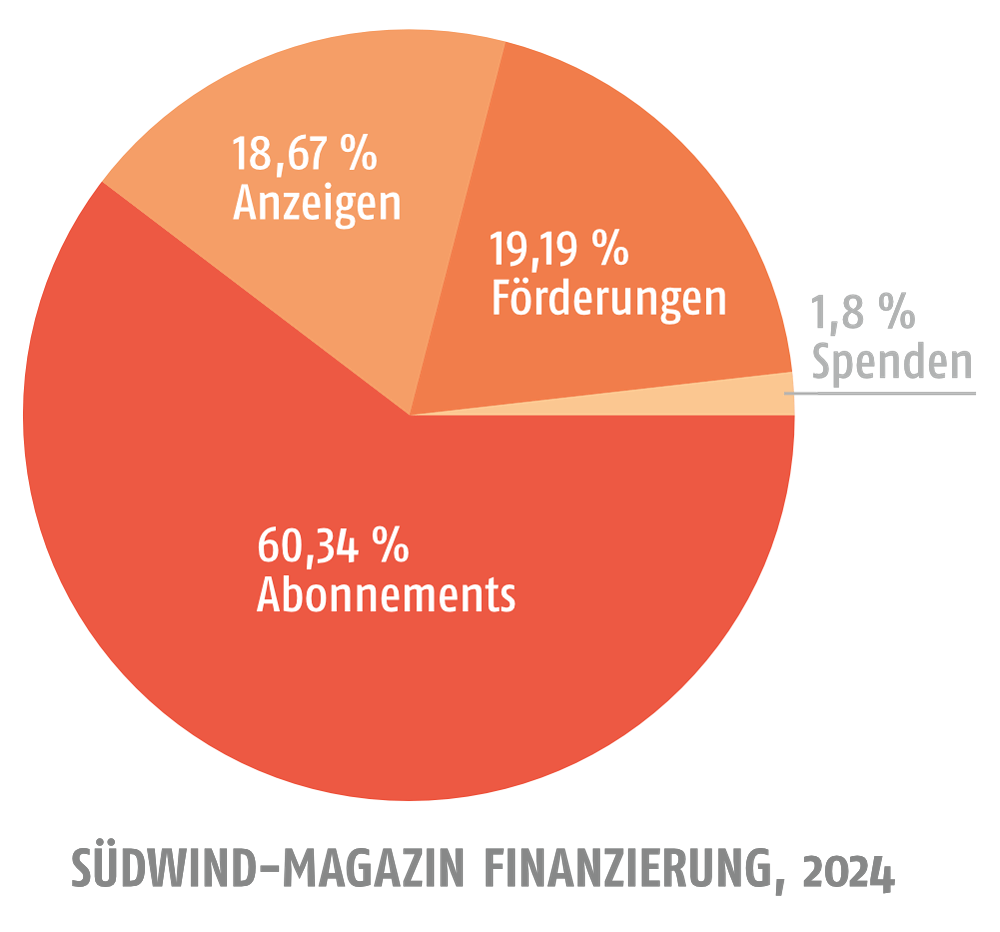Insbesondere nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Auflösen der ideologischen Blöcke belebte der Mythos vom Künstlernomaden die internationale Kunstszene. Trotz vielfältiger Kritik überlebt er in der Figur des freiheitsliebenden Reisenden: Selbstbewusst schwimmt er gegen den Strom der Zeit, umfährt auf seiner Odyssee geschickt ästhetische Regeln, ethische Normen, kulturelle Konventionen oder auch kommerzielle Erwartungen. Mit dem Notwendigsten ausgerüstet, bricht er von überall zu neuen Ufern auf, allzeit bereit, sich an jedem fremden Ort neu zu erfinden. Sein fröhliches Vagabundieren wird getragen von der Leichtigkeit eines abenteuerlichen, von unerwarteten Begegnungen erfüllten, schöpferischen Lebens. Im spielerischen Umgang mit vielfältigen Stilen und Materialien aus dem globalen Fundus setzt er neue Impulse für die Welt von morgen. Ob in Ausstellungskatalogen, Kunstmagazinen oder Kunstkritik, der die Welten durchquerende Nomade wird zum Künstlertypus des 21. Jahrhunderts stilisiert.
Ein beliebtes Motiv in Ausstellungen ist die Ästhetik des abgestellten Wohnmobils, die Reisen mit romantisch verklärten Erinnerungen an das jugendliche Trampen fernab von daheim auflädt. Wenn etwa die Escape Vehicles von Andrea Zittel (USA), der Karavan Joep van Lieshouts (Niederlande) oder Rirkrit Tiravanijas Campingbus (Thailand) individuelle Mobilität suggerieren, harmonisieren sie im Grunde unterschiedliche Lebenshintergründe im Bild einer euro-amerikanischen Freizeitkultur. Letztere wandelt sich zum Prototyp eines propagierten postmodernen Lebensstils mit dem selbstorganisierten, allzeit einsatzbereiten Künstler als Global Player. Dieser verkörpert eine ganz eigene Avantgarde – nämlich den in Medien beschworenen „Job-Nomaden des 21. Jahrhunderts“ als Vorhut der mobilen Dienstleistungsgesellschaft im flexiblen Kapitalismus. Seine Unabhängigkeit behält der Einzelkämpfer um den Preis sozialer Sicherheiten und einer festen Anstellung. Künstlerinnen passen sich an dieses Image an und sind in der Kunstszene zahlreicher vertreten als früher. Trotzdem bleiben sie als Ausnahmefrauen sowohl zahlenmäßig als auch auf der Karriereleiter weit hinter ihren männlichen Kollegen zurück. Immer noch dominieren Männer-Netzwerke von einflussreichen Sammlern, Kuratoren, Galeristen und Intellektuellen, deren Profil nicht selten in akademischen Zirkeln geformt und protegiert wird. Der nur scheinbar freie Wettbewerb um Stipendiengelder und Zugang zu Eliteschmieden sortiert die Förderungswürdigen.
Das Pathos unbegrenzter Mobilität und internationaler Präsenz durch globales Agieren verklärt das kleinunternehmerische Künstlergewerbe. Es täuscht über die seit den Anfängen des europäischen Kolonialismus durch Macht strukturierten Reiserouten hinweg. Bereits in der Renaissance diente die Künstlerreise der praktischen Schulung und dem Prestigegewinn. Inzwischen haben sich die Sehnsuchtsorte von Europa auf die ganze Welt ausgedehnt, aber auch die euro-amerikanischen Metropolen sind begehrte Destinationen für KünstlerInnen aus Übersee. Heutzutage bezieht der Artist in Residence zeitweilig Quartier in einem Atelier, das von marktinteressierten Institutionen gesponsert wird. In Österreich finanzieren beispielsweise die Neue Galerie Graz, Kunsthalle Krems und das Bundeskanzleramt – Sektion für Kunstangelegenheiten zusammen mit dem Verein KulturKontakt Austria solche Aufenthalte. Die Querwelteinreisen der NomadInnen dienen vorrangig der Netzwerkbildung, nicht unähnlich den gegenwärtigen Dynamiken der Arbeitswelt.
Der Mythos vom Künstlernomaden ist Effekt zunehmender Mobilität und dem damit verbundenen Freiheitsversprechen euro-amerikanischer Gesellschaften, ignoriert aber globale Flüchtlingsströme und Migrationsbewegungen als deren dunkle Kehrseite. Die fröhliche Wanderlust verliert an Romantik für KünstlerInnen aus einkommensschwachen oder durch Gewalt regierten Ländern. Ihr Reisepass verwehrt ihnen den ungehinderten Grenzübertritt gerade nach Europa und in die USA. Oftmals haben sie Probleme, im fremden Land mit den ihnen eigenen Symbolen verstanden zu werden und sich in einer neuen Sprache auszudrücken. Diese Schwierigkeiten thematisieren die Arbeiten der folgenden drei Künstlerinnen.
Mona Hatoum
1975 ging die als Palästinenserin in Beirut geborene Künstlerin Mona Hatoum nach London, wo sie sich bei Kriegsausbruch aufhielt, ins Exil. Ihre Installationen bezeugen einfühlsam die durch Gewaltregime verursachten Traumata, ohne mit spektakulären Details zu schockieren. Dunkle Räume, in denen von der Decke hängende Glühbirnen flackernde Schatten auf Wänden werfen, rot angeleuchtete Heizstäbe den Fluchtweg am Ende eines Tunnels versperren und Käfige aus Maschendraht gefängnisartige Mauern bilden, erteilen dem freien Nomadisieren eine Absage. Sie wollen weniger spektakulärer Erlebnisraum sein als ein Ort der Reflexion über Politik und Gesellschaft im Medium des Kulturellen. Sich auf ihre düsteren Seelenstimmungen einzulassen, kann eine mentale Beziehung zu Asylsuchenden herstellen, wo öffentliche Medien eher einen Keil hineintreiben. Die Art der Annäherung an die bedrückenden Situationen liegt letztlich jedoch im Ermessen der Betrachtenden. Hatoum bezieht sich durch Wahl, Gestaltung und Anordnung der Materialien auf ein bestimmtes, in unseren Köpfen verankertes Bildrepertoire und lenkt so lediglich ein Stück weit unsere Wahrnehmung. Nur so können ihre räumlich erfahrbaren Metaphern von Macht und Unterdrückung sprechen, die immer wieder Bewegungsfreiheiten einengen.
Chohreh Feyzdjou
Eine ebenso beklemmende Stimmung erzeugen die in Regalen archivierten und in Kisten verpackten schwarzen Leinwände der aus Iran nach Paris emigrierten Künstlerin Chohreh Feyzdjou, wo sie 1996 an einer schweren Krankheit starb. Weitere Malutensilien wie Pigmente, Tuben, Flaschen und Dosen stehen geordnet in Regalen, von einer staubig schmutzigen Patina überzogen. Feyzdjou wuchs als Jüdin unter Moslems in Teheran auf. Vor diesem Hintergrund können ihre nicht einsehbaren Bilder als Symptome einer Künstlerinnenreise gelesen werden, die von schmerzhafter Entfremdung zeugen. Als Künstlerin in der Diaspora einer Minderheit zugehörig wusste Feyzdjou um die Schwierigkeiten, verstanden, ja überhaupt wahrgenommen zu werden. So frei und spielerisch lassen sich Zeichen unterschiedlicher Kulturen nicht mischen, sollen sie nicht zum reinen Dekor werden. Der versperrte Blick auf die Gemälde zeugt somit auch von der immer unzureichend bleibenden Übersetzungsarbeit bei einem Wechsel von einer symbolischen Ordnung in die nächste. Nur all zu gerne würde man/frau die Leinwände einfach entrollen, doch würden wir das, was wir zu sehen bekommen, mehr begreifen?
Angesichts der globalen Bilderflut, die Meinungen und in Folge dessen auch Handlungen prägt, fragt diese Arbeit nach der universalen Verständlichkeit von Bildformeln. Wessen Symbole werden verstanden, welche bleiben warum auf der Strecke? So setzt die Installation einen Impuls, über Strukturen und Gesetzmäßigkeiten im Feld des Visuellen zu reflektieren. Diese sind eben nicht einfach nur objektiv gegeben. Das, was zu sehen gegeben wird, hängt immer davon ab, wer die Macht hat, es zu zeigen.
Carrie Mae Weems
Die Erfahrung, dass das, was gezeigt wird, eine Frage der Macht ist, machte auch die politisch aktive Fotokünstlerin Carrie Mae Weems. Für sie als Afro-Amerikanerin, 1953 in den USA geboren, zeigt sich in diesem Medium die Dominanz weißer Perspektiven darin, dass allgemein menschliche Situationen nicht mit Schwarzen repräsentiert werden können. Fotografien von Schwarzen und nicht die von Weißen werden von dem vorrangig weißen Publikum regelmäßig im Kontext von Rassismus diskutiert. Weems Entscheidung, Schwarze Sujets aufzugreifen, verfolgt das Ziel, verlorenes Wissen über die Geschichte der Black Community in den USA zu rekonstruieren und so eine Politik des Anti-Kolonialismus im Bereich visueller Darstellungen zu verfolgen. Ihre mit Texten kombinierten Fotografien erinnern an verdrängte Schwarze Geschichte von Heimat, Identität und dem Leben in der Diaspora.
Für ihre Sea Island Series Anfang der 1990er Jahre bereiste Weems die Südostküste der USA auf den Spuren afrikanischer Kultur und damit der Sklavereigeschichte. Palmenhaine, sumpfige Wiesen und verfallene Häuser, an denen man achtlos vorübergehen würde, avancieren zu markanten Orten. Diese Unorte lädt Weems mit Legenden über Widerstand gegen die weiße Sklavenhaltergesellschaft auf und schafft so Sehnsuchtsorte, die gemeinschaftsstiftend für die in der Diaspora lebenden Schwarzen wirken. Auch ihre Texte erzählen vom Wunsch nach freier, vielmehr befreiter Mobilität – Legenden von Sklaven, die nach Afrika geflüchtet und wieder auf die Plantagen zurück gekehrt sind, um anderen beizustehen. Dieser Traum speist sich aus der grenzenlosen Verzweiflung der versklavten Ahnen, bleibt spirituell, um der unsagbaren Verlassenheit angesichts fehlender Schwarzer Geschichtsbilder eine Heimat zu geben. Kunst übernimmt hier die Funktion der ästhetischen Bildung, um die durch den westlichen Kulturimperialismus verlorene Erinnerung zu formen.
Birgit Haehnel ist Kunsthistorikerin und war zuletzt Gastprofessorin an der Universität Osnabrück.
Näheres zu den hier ausgewählten Arbeiten in
„Inklusion : Exklusion. Versuch einer neuen Kartographie der Kunst im Zeitalter von Postkolonialität und globaler Migration.“
Hg. v. Peter Weibel, Steirischer Herbst.
Verlag: DuMont 1997.