
Ungleiche Ausgangslage
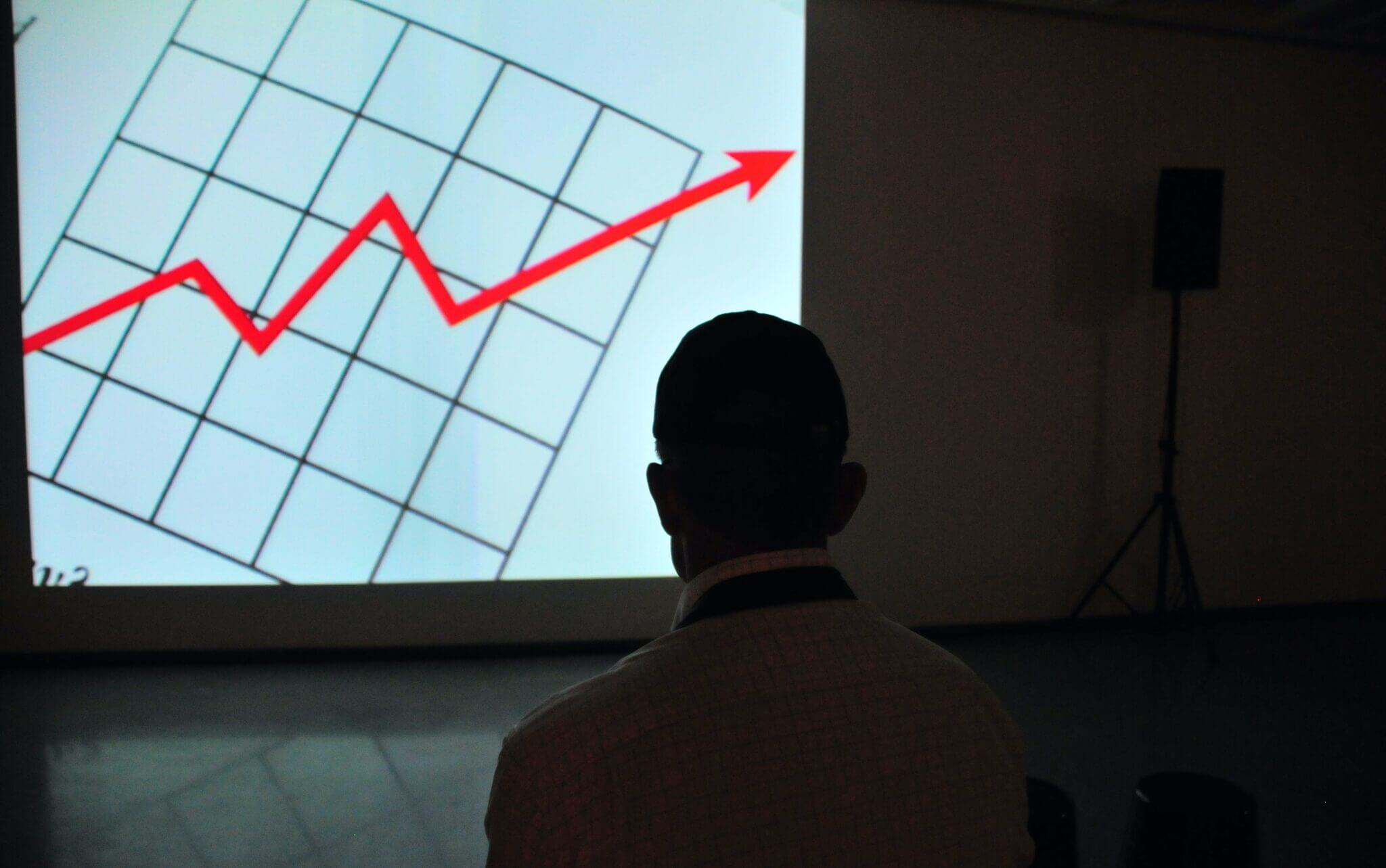
Startups in Afrika punkten mit weißen Gesichtern bei Investor*innen – einheimische Gründungen haben häufig das Nachsehen. Ein Kommentar.
Der deutsche IT-Dienstleister Stefan Kremer sorgt derzeit in Kenia für Aufsehen. Auf seiner Website „Hire a Mzungu“ („Miete einen Weißen“) bietet er sich als „weißes Gesicht“ für afrikanische Startups an. Zwar ist die Website ein Satireprojekt, sie macht aber auf ein ernstes Problem aufmerksam: Internationale Investor*innen finanzieren Startups in Afrika vor allem dann, wenn sie Weiße im Führungsteam haben.
Kremer kam auf die Idee mit der Website „Hire a Mzungu“, nachdem er ein Interview mit Robin Reecht gelesen hatte, dem französischen Gründer des kenianischen Online-Lieferdienstes Kune. Reecht hatte für den Aufbau seines Startups gerade eine Million US-Dollar eingeworben. Gegenüber der Plattform Techcrunch meinte der Jungunternehmer Mitte Juni: „Nachdem ich drei Tage in Kenia war, fragte ich herum, wo ich gutes Essen zu einem günstigen Preis bekommen kann. Und alle sagten mir, das sei unmöglich.“
Wenig Marktpotenzial. Der Aufschrei in sozialen Netzwerken war groß: Nicht nur, weil Reecht die Qualität der lokalen Gastronomie kritisierte. Sondern vor allem deshalb, weil er die hohe Summe für die Realisierung eines Konzepts bekam, das für viele Kenianer*innen wenig Marktpotenzial hat: Essen kann man in Nairobi an jeder Straßenecke kaufen. Und wenn’s schon eine Bestellung sein muss, liefern Motorradfahrer*innen alles überall hin. „White Privilege“ schimpften Vertreter*innen der einflussreichen kenianischen Twitter-Community #KOT (Kenyans on Twitter) völlig zu Recht.
Die Debatte um Kune ist kein Einzelfall, in der Szene brodelt es schon länger. Denn die „Silicon Savannah“ – wie die Tech-Szene um Nairobi genannt wird – steht bei Investor*innen seit Jahren hoch im Kurs. Die „Africa Startups Deals Database“ hat seit Jahresbeginn 2019 bis heute Investitionen in Höhe von 5,1 Mrd. Euro erfasst, 17 Prozentdavon gingen an Startups in Kenia. Damit liegt das ostafrikanische Land auf Platz 2 – hinter Nigeria und vor Südafrika.
Trotz der Aufbruchsstimmung finden afrikanische Unternehmer*innen wenig Gehör bei Investor*innen. Laut der Beratungsfirma Viktoria Ventures stammten in Kenia 2019 nur sechs Prozent der Gründer*innen, die über eine Million US-Dollar für ihre Startups einsammeln konnten, aus dem Land selbst.
Enorme Schieflage. Seit 2019 haben laut „Africa Startups Deals Database“ 868 Investmentgesellschaften in Startups in Afrika investiert. Drei Viertel dieser Gesellschaften haben ihren Sitz außerhalb des Kontinents. Ihnen fehlt es daher häufig an den notwendigen Marktkenntnissen und am Zugang zu afrikanischen Geschäftspartner*innen. Also setzt man auf weiße Gründer*innen, von denen man glaubt, sie besser einschätzen zu können. Auch wenn diese sich vor Ort bestenfalls mittelprächtig auskennen.
Den Kapitalgeber*innen sollte aber klar werden: Einheimische Gründer*innen sehen die spezifischen Herausforderungen in den 55 Ländern des Kontinents mit Sicherheit klarer. Ob es einen Online-Lieferdienst wie Kune in Kenia braucht oder auch nicht, können sie mit größerer Treffsicherheit beurteilen als ein französischer Unternehmer nach drei Tagen.
Investor*innen sind also in jedem Fall gut beraten, sich stärker in den pulsierenden Startup-Metropolen des Kontinents zu vernetzen und afrikanischen Talenten eine Chance zu geben, sich zu beweisen. Bleibt nur zu wünschen, dass Kremers Website „Hire a Mzungu“ einige auch tatsächlich zum Umdenken bewegt.
Martin Sturmer ist Gründer der Nachrichtenagentur www.afrika.info und lebt in Oberndorf bei Salzburg.






