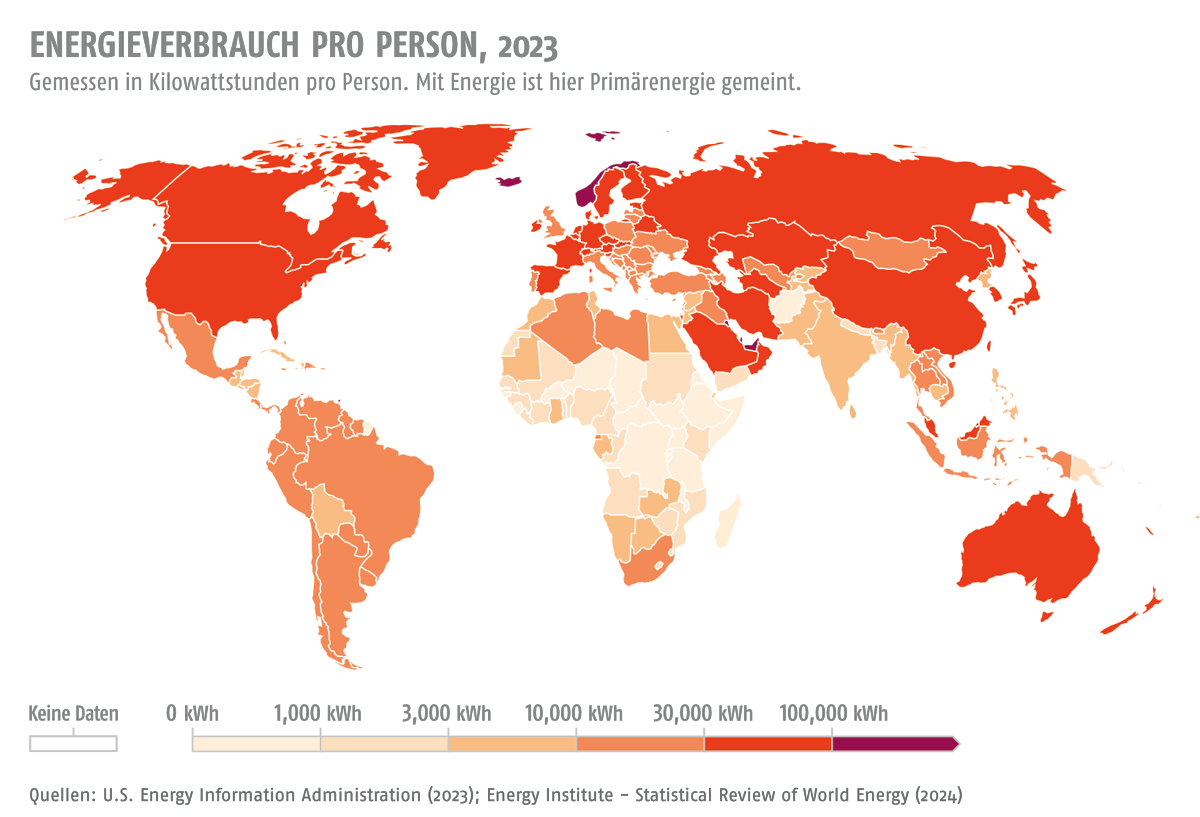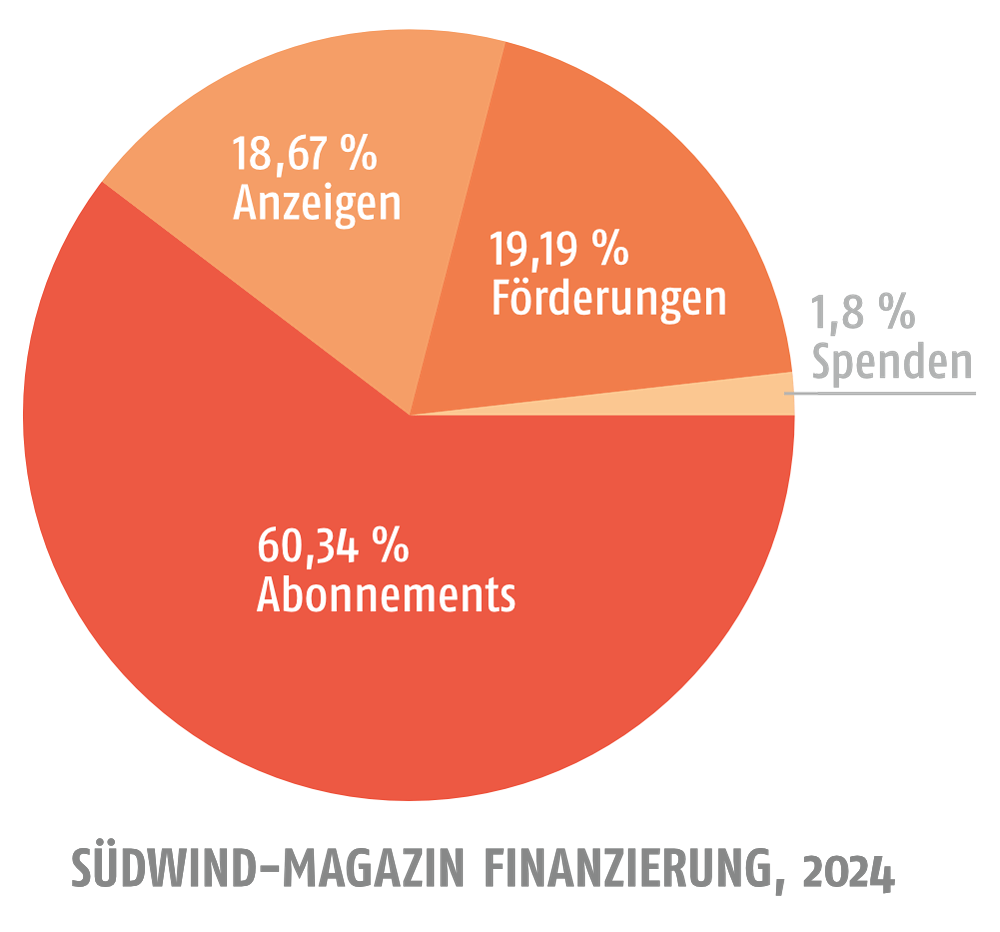
Teuer erkaufte Demokratie
Eine fast sechzehnjährige Militärherrschaft findet ihr Ende, doch eine grundlegende politische Erneuerung ist von Präsident Obasanjo nicht zu erwarten. Dieser erbt am 29. Mai ein Trümmerfeld in wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht.
Obasanjo wird das Trümmerfeld erben, das nahezu 16 Jahre Militärdiktatur hinterlassen haben. Noch nie waren die Nigerianer in ihrer Mehrheit so arm und rechtlos wie heute, noch nie hat in dem Land so wenig funktioniert, von den Institutionen über die öffentlichen Dienstleistungen bis hin zur Infrastruktur des Alltags.
Wenn die BewohnerInnen der reichen Ölfördergebiete im absoluten Elend leben und normale Gehälter zum Leben nicht ausreichen, kann die formale Wirtschaft gesellschaftliche Bedürfnisse nicht befriedigen. Wenn der Staat dem sozialen Zerfall tatenlos zuschaut und zugleich eine schmale, in die Weltwirtschaft eingegliederte Elite sich öffentlich sichtbar am Kollaps des eigenen Landes bereichert, kann die Politik gesellschaftliche Mißstände nicht beheben.
Nigerias Krise ist mehr als nur eine Krise der Ökonomie oder des Regierungssystems. „Die Kultur des Militärs ist in das Bewußtsein der Menschen eingedrungen“, sagt Ben Tomoloju, Theaterautor in Nigerias größter Stadt Lagos. „Das gesellschaftliche Leben ist von Elementen der Gewalt geformt. Die Leute erleben Illegalität als die natürliche Ordnung der Dinge.“
Obasanjo ist sich der Herausforderung bewußt. Aber kann er sie auch aufnehmen „Ich verstehe die klare Botschaft des nigerianischen Volkes“, sagte er am 2. März in seiner Dankesrede für den Wahlsieg. „Indem sie mir ihr Mandat gaben, haben sie mich gebeten, dieses Land beispielhaft zu führen. Sie wollen, daß ich sie auf den rechten Weg führe. Sie wollen, daß ich die Würde unseres Landes wiederherstelle. Sie wollen, daß ich unsere politischen Institutionen wiederbelebe und die Wirtschaft revitalisiere. Sie wollen, daß ich ihre Armut lindere und Korruption verringere. Sie wollen, daß ich die Sicherheit ihres Lebens und ihres Eigentums gewährleiste. Sie wollen Gerechtigkeit in einem Land, das sie wahrhaft ihr eigenes nennen können. Sie wollen noch viel mehr.“
Die Wortwahl ist verräterisch. Obasanjo sagt „ich“, wo eigentlich ein auf Gewaltenteilung beruhendes parlamentarisches System gemeint sein müßte. Der pensionierte General, den Vertraute als „Soldaten durch und durch“ charakterisieren, stilisiert sich selbst zum Führer, von dem alles abhängt. Ein Grund dafür könnte sein, daß er tatsächlich zwei Mandate bekommen hat, die sich widersprechen und die nur er vereinbaren kann: Neben dem Mandat des Volkes ein mindestens ebenso wichtiges Mandat des Militärs.
Obasanjo, der zum Zeitpunkt des Todes von Diktator Sani Abacha im Juni 1998 sterbenskrank im Gefängnis saß und erst einige Wochen später von Abachas Nachfolger Abubakar freigelassen wurde, ist nicht aus eigenem Antrieb und mit eigenen Mitteln Präsident geworden, auch nicht auf populären Druck hin. Es waren ausländische Freunde und hohe Generäle, angefangen von Ex-Diktator Ibrahim Babangida, die ihn im vergangenen Sommer dazu ermutigten und ihm die nötigen Gelder zur Verfügung stellten.
Nach seinem Sieg in einem Wahlkampf, der möglicherweise in die Geschichtsbücher als der bisher teuerste Schwarzafrikas eingehen wird, steht Obasanjo gegenüber seinen Gönnern in der Schuld. Das Ruhighalten der herrschenden Schicht ist Bedingung für ihre Machtübergabe an eine gewählte Regierung. Uund so haben diejenigen, die Nigerias Reichtümer in den Zeiten der Diktatur stahlen, von Obasanjo wenig zu befürchten.
Eine Klärung, wie und zu wessen Gunsten während der Militärherrschaft schätzungsweise bis zu 200 Milliarden Schilling aus den Staatskassen verschwanden, ist nicht zu erwarten. Der gewählte Präsident hat zwar die Bildung eines Sondergerichts gegen Korruption angekündigt – es soll allerdings nicht rückwirkend tätig sein.
In einer weiteren Rede nach seiner Wahl erklärte Obasanjo, dies sei „nicht die Zeit für den Blick zurück im Zorn“. Man müsse lieber „nach vorne“ schauen.
„Vorne“, das hat Obasanjo immer wieder gesagt, bedeutet eine erhoffte Ära massiver ausländischer Investitionen, um Nigerias immenses wirtschaftliches Potential zu nutzen.
Obasanjo – und nicht nur er – setzt auf sein außerordentlich positives Bild im Ausland, um Nigeria von seinem schlechten Image als Gaunerstaat zu befreien und frisches Geld ins Land zu bringen.
Ausländische Investoren sind bisher nur in der Ölförderung wirklich aktiv, wo zum Beispiel der Shell-Konzern bereits Pläne für neue Milliardenprojekte zirkulieren läßt. Die Ölförderung ist jedoch gegenüber dem Rest der nigerianischen Wirtschaft relativ autark.
In jedem Wirtschaftszweig besteht immenser Reparatur- und Erneuerungsbedarf. In Nigeria muß so gut wiel alles neu aufgebaut werden: vom Netz der Ölpipelines, die das Land durchziehen und allesamt veraltet sind – wie die an die 1000 Todesopfer fordernde Explosion der wichtigsten Nord-Süd-Pipeline vergangenes Jahr bewies – über die kaputten Raffinerien zu den längst kollabierten Netzen der Strom- und Wasserversorgung, der Telekommunikation und der Eisenbahn.
Geplant sind daher großflächige Privatisierungen in all diesen Bereichen. Doch ist kaum zu erwarten, daß ausländische Konzerne für die maroden nigerianischen Staatsbetriebe Schlange stehen. Ein gängiger Witz besagt, die Privatisierung der Telefongesellschaft Nitel sei leider daran gescheitert, daß sie telefonisch nicht zu erreichen war.
Zunächst werden also vermögende Einheimische die Firmen erwerben, um dann selber ausländische Partner zu suchen. Wer diese Vermögenden sein werden, ist relativ klar – eben jene, die vom organisierten Diebstahl der Militärherrschaft profitierten und jetzt Milliarden in der Tasche bzw. auf ausländischen Konten haben.
Oppositionelle prophezeien bereits, daß der immens reiche Ex-Diktator Babangida, ein Freund Obasanjos, demnächst als neuer Eigentümer der wichtigsten Staatsbetriebe in Erscheinung treten werde.
Wahrscheinlich ist das der einzige Weg, um die gestohlenen Gelder der Militärherrschaft doch noch nach Nigeria zurückzuholen. Aber unweigerlich wird damit die gegenwärtige Machtelite weiter gestärkt. Nigerias Demokratie wird teuer erkauft – sehr teuer.
Von dem Wunsch vieler NigerianerInnen nach einer grundlegenden politischen Erneuerung bleibt da wenig übrig. Demokratie, so hoffte bisher Nigerias Demokratiebewegung, müsse auch bedeuten, die Bundesrepublik Nigeria als wahrhaft föderalen Staat neu zu gründen und die Herrschaft einer schmalen Elite zu brechen, deren geistige Heimat die Militärakademie der nordnigerianischen Stadt Kaduna ist.
Die Elite hat dem jetzt nur so weit Rechnung getragen, daß sie mit Obasanjo einen Sohn des traditionell marginalisierten Südens an die Staatsspitze trägt. Daß er in seinem eigenen Yoruba-Volk am wenigsten Stimmen bekam, zeigt, wie wenig man ihm dort vertraut.
Politische Strukturreformen, zum Bespiel die Bildung starker Regionen, sind unter Obasanjo nicht in Sicht. Selbst der aufgeklärte Juntachef Abubakar hat sich nicht getraut, eine öffentliche Debatte darüber zu führen, welche Verfassung ein demokratisches Nigeria haben sollte. Den gesamten Demokratisierungsprozeß bis zu den Präsidentschaftswahlen organisierte er per Dekret, und die verfassungsmäßige Natur der zu wählenden Ämter blieb im Dunkeln.
Die Verfassung, mit der Obasanjo regieren wird, wurde unter Abubakar hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet. Voraussichtlich wird sie auf eine starke Präsidialverfassung hinauslaufen, ähnlich der, die Obansajo während seiner Zeit als Diktator 1976-79 schreiben ließ.
Vermutlich hat der neugewählte Staatschef also recht, wenn er bei der Aufzählung der Aufgaben der kommenden gewählten Regierung immer „ich““ sagt. Aber dieses „Ich““ wird in der Realität wohl weniger als allmächtige Leuchtfigur in Erscheinung treten, sondern als schillernder Schnittpunkt der sehr unterschiedlichen Interessen und Erwartungen, die aus dem „neuen Nigeria“ an den Präsidenten herangetragen werden.
Der Autor ist Afrika-Redakteur der Berliner