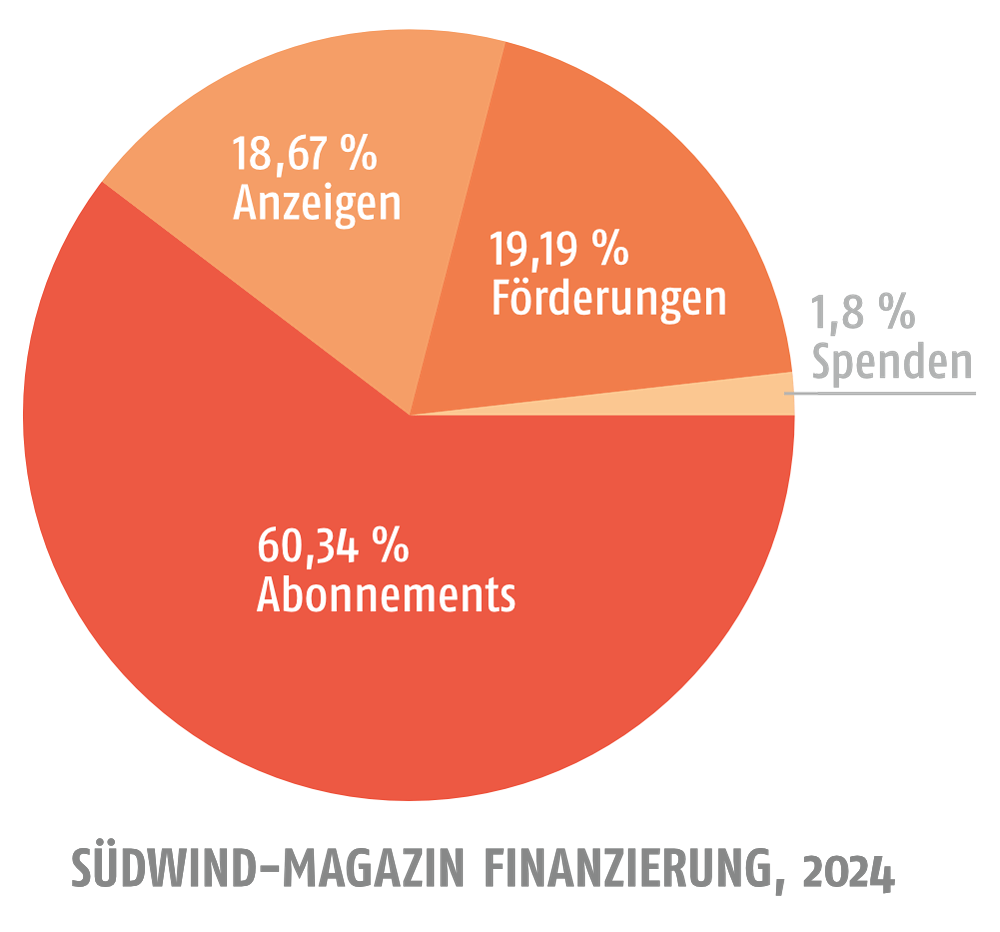Es war einmal …“ So beginnen die Erzähler am Jemaa el-Fna („Platz der Toten“) in Marrakesch ihre Geschichten, wenn sich das Publikum um sie herum zur halqa, zum magischen Kreis, schließt. Fast hätte man von ihnen ebenfalls nur noch in der Vergangenheitsform reden können. Denn dem Jemaa el-Fna, dieser vermutlich größten Open Air-Bühne der Welt mit Berbermusikern, Koranlesern, Kräuterkundigen, Hennakünstlerinnen, Akrobaten und Schlangenbeschwörern, drohte Gefahr: Zum einen durch ambitionierte Bauprojekte, zum anderen durch fehlenden Nachwuchs unter den Geschichtenerzählern. Bis der in Marrakesch lebende spanische Autor Juan Goytisolo mit einem Artikel über mündliche Traditionen den Impuls gab, der schließlich zur UNESCO-Proklamation der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes führte. Heute ist die Erzählkunst am Jemaa el-Fna erklärtes Weltkulturerbe und steht als eines von 90 „Meisterwerken“ quasi unter Denkmalschutz. Dafür sorgt die in diesem Jahr in Kraft getretene UNESCO-Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturerbes.
Lassen sich „kulturelle Räume“ wie der Jemaa el-Fna oder „Formen des kulturellen Ausdrucks“ wie der brasilianische Samba de Roda so schützen, als wären sie statische Denkmäler, Lehmbauten oder Schlösser? Meine Antwort ist ja und nein: Nein, wenn Erhaltung bedeutet, dass Adaptionen und Veränderungen nicht inbegriffen sind. Ja, wenn diesen Traditionen mehr Entfaltungsraum und Möglichkeiten zugestanden werden. Denn sonst werden „Erbstücke“ wie die westafrikanische Maskenperformance Gèlèdè, die armenische Duduk-Musik, das Ifa-Weissagungssystem in Nigeria oder das Rabinal Achi-Tanzdrama in Guatemala verschwinden. Durch Industrialisierung, bewaffnete Konflikte, Tourismus, Landflucht, Umweltverschmutzung oder kulturelle Standardisierung geht nicht nur kulturelles Wissen verloren. Auch die Trägerinnen und Träger solcher Traditionen werden weniger. Doch bringt die Bewahrung lebendigen Kulturerbes nicht die Gefahr der „Musealisierung“ mit sich, nach dem Motto „zu Tode geschützt ist auch gestorben“?
Ja, durchaus, doch das ist nicht die Hauptsorge der VertreterInnen jener Kulturen, die von der UNESCO für ihre Tänze, Rituale, Mythen, Epen oder Musik das Prädikat „Meisterwerk“ verliehen bekommen haben. Ihnen ist zunächst einmal wichtig, ihre Präsenz in der Welt zu demonstrieren – auch durch Museen. Für die Garinagu in Belize zum Beispiel war die Eröffnung eines Museums ihrer Garifuna-Kultur im November 2004 ein Höhepunkt. Die Nachfahren jener hybriden Mischung von Arawak, Kariben und AfrikanerInnen, die Ende des 18. Jahrhunderts von den Engländern von der Karibikinsel St. Vincent deportiert wurden, betrachten dieses Museum als konkrete und symbolische Heimat: Ein Ort, der ihnen ermöglicht, ihre bis heute marginalisierte Kultur darzustellen.
Als „Achtung jener Menschen, die ungebildet sind und im Elend leben“ interpretiert die brasilianische Historikerin Wlamyra Albuquerque die Anerkennung des Samba de Roda als Weltkulturerbe. Die Urmutter des Samba ist auf den Tabak- und Zuckerrohrplantagen im Hinterland von Salvador de Bahia entstanden und wird bis heute, vorwiegend von der älteren Bevölkerung, mit Hingabe gesungen, gespielt und getanzt. Selbstverständlich gibt es Adaptionen: Akkordeon und Ukulele sind dazugekommen, die Viola, vor zwanzig, Jahren noch das wichtigste Instrument, ist verschwunden. Das gehört dazu. Wohl könnte man über Archivaufnahmen den Samba de Viola rekonstruieren. Doch eine kulturelle Form „wiederzubeleben“ ist nicht gleich sie zu „vermitteln“. Allzu leicht gerät die Wiederbelebung zur Folklore, wie es die Erfahrung mit bestimmten Tanzformen gezeigt hat.
Auch die Inszenierung des alljährlichen Garifuna Settlement Day, mit dem die Garinagu der Landung ihrer Vorfahren in Belize gedenken, hat folkloristische Elemente. Die Forderungen dieser Minderheit an den Staat sind aber handfest und durchdacht: Integration in die Tourismuskonzepte und damit Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung; Förderung der Garifuna-Sprache in den Schulen, Anerkennung als Indigene. Kulturelles Erbe zu schützen hat eben auch eine politische und wirtschaftliche Dimension.
Aber was, wenn die Traditionen den Richtlinien des 21.Jahrhunderts zuwiderlaufen, mit Menschen- und Frauenrechten nicht kompatibel sind? Wenn z. B. Heilkunst und Kräuterwissen eifersüchtig von Männern gehütet werden, oder nur sie es sind, die Lieder und Epen darbieten dürfen? Was fangen wir heute mit einem unter Schutz stehenden Erbe an, das an vergilbten Gesellschaftsmodellen festhält? Sollte es dann nicht heißen: „Meisterwerk, nein danke“?
Das Beispiel des Jemaa el Fna zeigt andere Möglichkeiten: Noch vor dreißig, vierzig Jahren betraten Frauen den Platz nicht einmal als Zuschauerinnen. Heute bevölkern sie ihn als Hennakünstlerinnen, Wahrsagerinnen und gelegentlich Musikerinnen zumindest am Rande. Diesen peripheren Raum will das Komitee zum Schutz des Jemaa el-Fna in Zukunft erweitern: Schließlich war die Erzählkunst im Maghreb, so der Schriftsteller Tahar Ben Jelloun, „zunächst einmal Sache der Frauen“.
Die bisher neunzig geschützten „Erbstücke “ zeigen, wie eine Kette mit kostbaren alten Steinen, die Buntheit und Vielfalt der existierenden kulturellen Ausdrucksformen. Diese Schmuckstücke benötigen aber nicht nur die entsprechende Pflege, sondern auch neue Fassungen, damit sie tragbar werden. Eine orale Kultur muss mit Schrift, Radio, Fernsehen und Internet Verbindungen eingehen, denn nur in der daraus entstehenden „hybriden Qualität“ (Juan Goytisolo) wird die Zukunft der Tradition liegen.