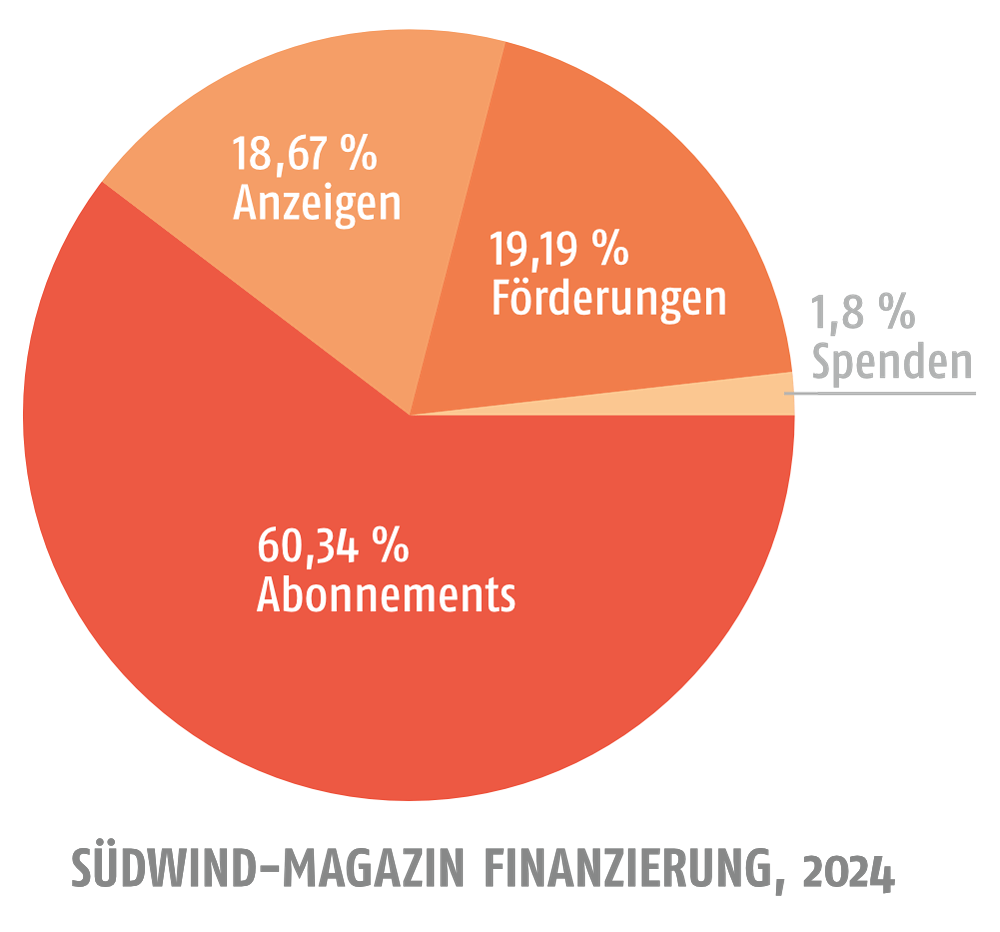Die Ölindustrie schickt jedes Jahr den Weihnachtsmann ins Dorf, mit Geschenken für die Kinder“, eröffnet mir Robert Thompson mit einem Augenrollen, wie um mir zu sagen: Die schrecken vor gar nichts zurück. Wir sitzen im Waldo Arms, dem schlichten Hotel von Kaktovik. „Sie schicken uns Wassermelonen und Obst“, erzählt Robert weiter. „Sie haben Funkgeräte in den Walbooten installiert. Sie geben uns kostenloses Benzin. Sie schicken Leute, die sich hier einschmeicheln sollen – Exxon kam zur Abschlussfeier der High School und schenkte allen AbsolventInnen einen Laptop! Public Relations natürlich, das gehört zur Strategie. Wir sind ihnen eigentlich egal, sie wollen nur das Öl.“
Robert – ein Vietnamveteran und angesehener Iñupiat-Tour-Guide – ist seit langem eine Leitfigur im Kampf gegen Bohrgenehmigungen im Arctic National Wildlife Refuge. Seine leidenschaftliche Gegenwehr hat ihn bereits tausende Meilen weit weg von seiner Heimat getrieben, die er kennt wie kaum ein anderer – als Lobbyist nach Washington und bis nach London, um Investoren über die Risiken der Ölförderung zu informieren. Die Ölindustrie zu stoppen ist für Robert eine Frage des Überlebens. „Ein Ölunfall könnte das Ende unserer Kultur bedeuten, die wir seit tausenden Jahren praktizieren. Das Aussterben der Meeressäuger. Das Öl aus dem Exxon-Valdez-Unfall in Südalaska vor 20 Jahren wirkt immer noch wie Gift. Im Polarmeer wird es höchstwahrscheinlich noch länger dauern, weil das Wasser kälter ist.“
Praktisch seit der Entdeckung des größten nordamerikanischen Ölvorkommens in der Prudhoe Bay, weniger als 400 km westlich von hier an der Küste, kam Katkovik nicht mehr zur Ruhe. Die Frage, ob im Schutzgebiet nach Öl gebohrt werden soll oder nicht – es handelt sich um die letzten fünf Prozent der North Slope (das Gebiet nördlich der Brookskette bis zur Küste, Anm. d. Red.), wo nicht nach Öl oder Gas gesucht werden darf – hat die USA polarisiert. Seit 30 Jahren ging die Diskussion jedes Mal wieder los, wenn in Washington abgestimmt wurde (der Kongress muss Bohrtätigkeiten genehmigen) oder Präsidentschaftswahlen stattfanden. Die Menschen in Katkovik gerieten ins Kreuzfeuer und wurden von beiden Seiten benutzt und missbraucht, um die jeweilige Position zu rechtfertigen.
Die Positionen im Dorf selbst sind nicht so eindeutig, wie das die Öllobby oder Umweltorganisationen gerne darstellen würden. „Die Leute hier sind bis zu einem gewissen Grad für eine Ölförderung am Festland“, räumt Robert ein. „Jahrelang hat man ihnen gesagt, dass sie das unterstützen müssen, damit die Unternehmen nicht Offshore (auf dem Meer, Anm. d. Red.) explorieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier für eine Offshore-Ölförderung eintritt. Aber man hat sie belogen.“
Sie wurden mit mündlichen Zusicherungen und finanziellen Zuwendungen von Ölkonzernen bombardiert, denen klar ist, welchen enormen Wert ihre Zustimmung hätte, sowohl für ihre PR als auch in rechtlicher Hinsicht, aber mangels derselben auch ihre Abhängigkeit. Praktisch alles, was das Leben hier im hohen Norden fast unermesslich leichter gemacht hat, wurde mit Ölgeld bezahlt.
Um zu verstehen, wie sich die indigene Bevölkerung Alaskas derart in diesem Spinnennetz aus Konzerninteressen verfangen konnte, brauchte ich eine Lektion in Geschichte. Ich bekam sie von Faith Gemmill, einer Gwich’in aus Arctic Village, der einzigen anderen Siedlung im Schutzgebiet, an seinem südlichen Rand. Die Gwich’in in Arctic Village sind seit langem geschlossen gegen jede Ölexploration: Sie sind überzeugt, dass die Karibu-Herde, von der sie leben, darunter leiden würde.
Faith koordiniert eine Organisation namens REDOIL („Resisting Environmental Destruction on Indigenous Lands“). Bei meinem Besuch in ihrem Büro zeigte sie mir auf einer Karte jeden Ort in ganz Alaska, wo REDOIL-Mitglieder gegen umweltzerstörende Projekte kämpfen. Ich erfuhr vom Kampf in der Prudhoe Bay, wo jedes Jahr 400 Ölunfälle passieren und 70.000 Tonnen Schadstoffe in die Umwelt emittiert werden. Ich weiß nun, dass ein Stück weiter an der Küste ein neues Kohlebergwerk samt Hafen errichtet werden könnte, wobei die Kohle großteils nach China exportiert würde. Sie erzählte mir von Nuiqsut, einem von Ölförderanlagen umzingelten Dorf in der North Slope, wo Asthma und Krebs grassieren, das Karibu-Fleisch gelb ist und die Fische seltsam schmecken. Und davon, dass einige indigene Gemeinschaften freiwillig aufgehört haben, gefährdete Tierarten zu jagen, aber machtlos gegen die Verschmutzung durch die Industrie sind, an der genau diese Tiere zugrunde gehen. Ich bekam den Eindruck, dass sich die Menschen hier in einer Art Belagerungszustand befinden.
Faith erzählte mir von der unheilvollen Episode in der Geschichte Alaskas, die zu der heutigen Situation geführt hat. Nach der Entdeckung der Ölvorkommen 1968 begriff die US-Regierung, dass sie die anhängigen Landrechtskonflikte mit der indigenen Bevölkerung der Region beilegen musste, um an das Öl heranzukommen. Die Antwort war ein Gesetz, der Alaska Native Claims Settlement Act. Darin wurden zwar Landrechte zugestanden, aber nicht der traditionellen Führung der jeweiligen Gemeinschaft, sondern neu geschaffenen Unternehmen. Deren gesetzlicher Auftrag war es keineswegs, für das Wohlergehen der Menschen zu arbeiten, die Kultur zu bewahren oder die Jagdgebiete zu schützen: Sie sollten einfach Gewinne machen, wie mir Faith erklärte. Der Rest des Landes wurde Eigentum des Bundesstaats oder der Bundesregierung. Damit konnte die Erschließung beginnen, und so wurde auch die Trans-Alaska-Pipeline nach Valdez gebaut, um das Öl aus der Arktis vermarkten zu können.

Das Problem besteht darin, dass das Land von beliebigen anderen Unternehmen – inklusive ausländischer Multis – erworben werden könnte, wenn die „indigenen“ Unternehmen keinen Gewinn mehr machen. Da niemand direkt von Exxon & Konsorten regiert werden will, bleibt ihnen kaum eine andere Wahl als die Entwicklung selbst voranzutreiben und sich mit Öl-, Bergwerks- und Holzunternehmen zusammenzutun. Genau das war beabsichtigt, meint Faith: „Das war ein Gesetz, um uns zu assimilieren, uns zu spalten, politisch zu schwächen, und um an unsere Ressourcen heranzukommen.“
Auch in Kaktovik existiert ein „indigenes“ Unternehmen, für das Robert Thompson wenig übrig hat. „Das Management des Unternehmens hat sich selbst als Führung unseres Volkes dargestellt. Das sind sie aber nicht.“ 1983 verkauften sie die Explorationsrechte im Schutzgebiet (Festland) für 30 Mio. US-Dollar an BP und Chevron-Texaco. Seit damals fordern die Unternehmen lautstark, dass ihnen der Kongress endlich grünes Licht geben soll. „Wenn der Kongress dem zustimmt, stimmen sie letztlich für den Profit von BP“, so Robert. „Das sollte eigentlich allen klar sein, anstatt dass man sich hinter Phrasen versteckt wie ‚naja, die indigene Bevölkerung will es ja'“.
Da der Klimawandel die bisher kaum erschließbaren enormen Ressourcen der Arktis zugänglicher macht, werden in allen Ländern des hohen Nordens Pläne für eine massive Industrialisierung geschmiedet. Das Spannungsverhältnis zwischen Profit und Umweltschutz, das damit entsteht, kam auch auf dem Gipfel der indigenen Völker über den Klimawandel in Anchorage offen zutage, an dem ich teilgenommen hatte. Bei den Debatten über die Formulierung der Abschlusserklärung gab es einen Streitpunkt. Die Mehrheit der Delegierten, die Gemeinschaften rund um die Welt vertraten, wollte zu einem Moratorium für die Erschließung fossiler Rohstoffe auf dem Land indigener Völker aufrufen – eine radikale, aber vernünftige Forderung, wenn man bedenkt, wie viel Schaden damit vor Ort und weltweit angerichtet wird. Aber VertreterInnen aus der Arktis wehrten sich dagegen mit dem Argument, ihre wirtschaftlichen Rechte würden dadurch verletzt.
Der Konflikt konnte nicht beigelegt werden. Die tief gehende Spaltung in dieser Frage musste in die Schlusserklärung aufgenommen werden, ein trauriges Ergebnis eines Treffens, das ansonsten von beeindruckender Einheit geprägt war. Am heftigsten hätten sich die Samen aus Norwegen und die Inuit aus Kanada gegen ein Moratorium gewehrt, wie mir Faith Gemmill erzählt – beides Länder mit großen Plänen für die zukünftige Ausbeutung der Ressourcen. Andere Delegierte aus der Arktis wären sehr wohl dafür gewesen.
Ist also die Plünderung der verbleibenden Reichtümer der Arktis eine ausgemachte Sache? Nicht unbedingt. Indigene Gemeinschaften, Umweltorganisationen, RechtsexpertInnen und Abgeordnete haben bereits einige wesentlichen Erfolge erzielt. Die Existenz des Arctic National Wildlife Refuge ist selbst ein Beispiel. Das Schutzgebiet konnte seit 30 Jahren verteidigt werden, wenn auch ab und zu nur um Haaresbreite. Robert glaubt, dass die neue US-Regierung eine Atempause bringen wird, die nach dem Dauerdruck während der vom Ölfanatismus geprägten Bush-Jahre dringend nötig ist: „Falls der Senat ein Gesetz beschließt, würde Obama sein Veto einlegen. So lange er da ist, kann uns also nichts passieren. Und jetzt versuchen wir, eine ‚Wilderness Bill‘ durchzubringen, um das Gebiet auf Dauer unter Schutz zu stellen.“
Faith kann von anderen Erfolgen erzählen. „Wir haben Shell davon abgehalten, in der Beaufortsee zu bohren. Vergangenen November entschied ein Gericht, dass das Unternehmen bei seinen Versuchen, die Offshore-Exploration voranzutreiben, gegen Umweltgesetze verstoßen und die Auswirkungen auf unsere Subsistenzkultur nicht berücksichtigt hat. Die indigene Bevölkerung in Point Hope leistet heftige Gegenwehr gegen die Erschließung der Tschuktschensee, die sie ihren Garten nennen, und hat eben auch einen großen Sieg errungen: In ihrem Verfahren wurde entschieden, dass der gesamte Offshore-Entwicklungsplan der US-Regierung ungesetzlich ist!“
Faith ist allerdings überzeugt, dass sich letztlich das ganze System verändern muss. „Meine Hoffnung ist, dass ich erlebe, wie die indigenen Völker in Alaska sich verbünden und sich das zurückholen, was uns genommen wurde. Darüber wird tatsächlich diskutiert“, versichert sie mir. „Unsere Leute begreifen, dass der Alaska Native Claims Settlement Act ein Unrecht war und wir uns unsere Rechte wieder zurückholen müssen. Unsere Führer überlegen derzeit, wie man diese indigenen Unternehmen rechtlich den Stämmen unterstellen kann.“
Für Robert sind es nicht unbedingt die Unternehmen, die für alles verantwortlich gemacht werden sollten. „Die Ölindustrie, das sind die Bösen, klar. Aber in Wirklichkeit liefern sie doch nur, was die Leute wollen. Bis wir die Leute auf etwas anderes bringen, wird uns das Problem noch eine Zeit lang verfolgen.“ Gesagt, getan: Um seiner Gemeinschaft zu beweisen, dass es Alternativen zum Öl gibt, stellt er diesen Sommer ein Windkraftwerk in Kaktovik auf. „Man tut, was man kann“, meint er achselzuckend.
Copyright New Internationalist