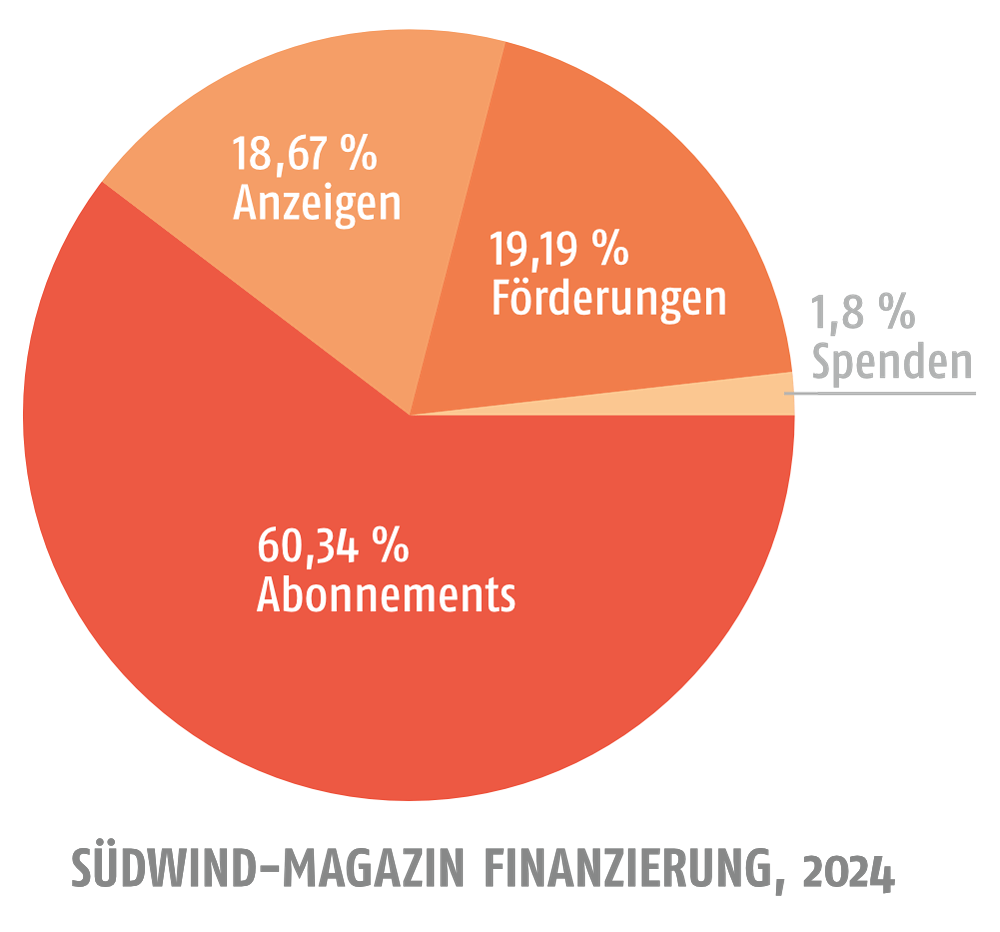Wir ließen das brennende Dorf hinter uns und kamen zum Waldrand. Ich hatte keine Ahnung, ob jemand aus meiner Familie entkommen war oder ob sie alle ermordet worden waren. Ich hatte auch keine Ahnung, was nun mit mir geschehen würde. Und so endete meine wundervolle, glückliche Kindheit, und mein Leben als Sklavin begann“, berichtet Mende Nazer in ihrem erschütternden Buch, das das Augenmerk einer breiten Öffentlichkeit auf ein Tabuthema gelenkt hat. Sklaverei in der heutigen Zeit und vor allem: Sklaverei mitten in Europa.
Gibt es in Europa heute wirklich noch Sklaverei? Ja, es gibt sie. Obwohl es keine allgemein gültige Definition gibt, was denn eigentlich unter Sklaverei zu verstehen ist, werden damit meist Formen des Menschenhandels, insbesondere Mädchen- und Frauenhandel zum Zwecke der Prostitution oder erzwungener Heirat und Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft verstanden oder zumindest als sklavereiähnlich beurteilt. Gleiches gilt auch für extreme Formen der Zwangsarbeit.
Als Mende Nazer etwa zwölf Jahre alt war, überfielen im Bürgerkrieg arabische Milizen ihr Dorf in den Nubabergen des Sudan. Frauen wurden vergewaltigt, Kinder in die Hauptstadt Khartoum verschleppt. Dort wurde Mende für umgerechnet 150 US-Dollar als Sklavin verkauft. „Yebit” wurde sie nun genannt, das arabische Wort für jemanden, der es nicht wert ist, einen Namen zu tragen. „Du gehst mit dieser Dame, du musst ihr gehorchen, denn sie ist jetzt deine Herrin“, wurde ihr befohlen. Für ihre arabische Herrin muss Mende hart arbeiten, sie wird geschlagen, misshandelt und sexuell missbraucht. Sechs Jahre lang. Mende ist mittlerweile 19, als sie von ihrer Herrin weitergereicht wird: an einen hochrangigen Mitarbeiter der sudanesischen Botschaft in London.
Vor allem für Frauen und Kinder aus der „Dritten Welt“ gibt es in Europa Arbeitsverhältnisse, die unter den Begriff der Sklaverei einzuordnen sind. Als Nährboden der Sklaverei zeigen sich immer wieder zwei Faktoren: Armut und Diskriminierung. Es gibt auch Familien, welche die Töchter ins Ausland verkaufen, eher selten sind gewaltsame Entführungen. Egal ob Tänzerinnen oder Köchinnen, Landarbeiterinnen oder Hausgehilfinnen, immer wieder geraten vor allem Frauen in die modernen Formen der Sklaverei.
Mende Nazer ist nur ein Fall von vielen anderen. Versklavte Menschen sind überall zu finden, in allen Ländern und allen Wirtschaftsbereichen. Die meisten SklavInnen arbeiten weltweit in der Landwirtschaft, aber auch in Ziegeleien, Steinbrüchen, Bergwerken und in Köhlereien gibt es Sklaven. Sie schleifen Edelsteine, stehen an Webstühlen und – oft sehr junge – Sklavinnen werden in privaten Haushalten schamlos ausgebeutet.
Die häufigste Form heutiger Sklaverei ist die Schuldknechtschaft, bei der Menschen ohne oder mit nur geringer Entlohnung zur Begleichung einer tatsächlichen oder behaupteten „Schuld“ arbeiten müssen: Rasch wachsen Formen von Sklaverei, die sich auf betrügerische Arbeitsverträge gründen, und nicht zuletzt der globalisierte Menschenhandel. Ihm fallen jährlich zwischen 700.000 und zwei Millionen Frauen und Kinder zum Opfer. Allein in Westeuropa werden 500.000 Frauen als Opfer des Menschenhandels zur Prostitution gezwungen.
Zum 76. Mal jährte sich im Dezember der Entschluss der internationalen Gemeinschaft, Sklaverei weltweit abzuschaffen und die entsprechende erste internationale Konvention dazu anzunehmen – die Konvention gegen Sklaverei. Das Beispiel Mende Nazer zeigt: Dieser Vertrag ist auch im 21. Jahrhundert keineswegs obsolet geworden. Sklaverei und Leibeigenschaft sind durchaus noch gegenwärtig, wenn auch meist in Form von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Menschenhandel. Diese modernen Formen der Sklaverei finden sich auf jedem Kontinent. Heute gibt es mehr Sklavinnen und Sklaven in aller Welt als in den vergangenen Jahrhunderten aus Afrika verschleppt wurden. Darauf verweist die neue „Europäische Aktion zur Überwindung von Sklaverei und Zwangsarbeit“. Die Schätzungen reichen von mindestens 27 Millionen bis zu 100 Millionen Menschen in Sklaverei und Zwangsarbeit.
Es werden zwar fast jährlich immer neue Protokolle zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels beschlossen, aber wie UNO-Generalsekretär Kofi Annan treffend bemerkt hat, liegt der wahre Test internationaler Verträge in ihrer Umsetzung. Die nationalen Gesetze müssen durchgesetzt werden. Opfer der Sklaverei benötigen Schutz und Unterstützung, um Rechtsmittel zu ergreifen oder Entschädigung zu erhalten.
Wie schwierig es jedoch ist, wegen dem Delikt der Sklaverei vor Gericht Prozesse zu führen, zeigt die aktuelle Lage in Brasilien. Erst im Jahre 1888 hat Brasilien die Sklaverei offiziell abgeschafft, doch es gibt sie bis heute. Laut amnesty international nimmt dort die Sklaverei sogar wieder zu. Vor allem im Norden und Nordosten wird sie von etlichen Großgrundbesitzern in modifizierter Form weitergeführt.
Kein Einzelfall: Max Cangussi hatte etwa in Maranhão, dem ökonomisch am wenigsten entwickelten Teilstaat Brasiliens, Männer anwerben lassen, um 230 Kilometer vom nächsten Ort entfernt Weideland einzäunen und Bäume und Sträucher entfernen zu lassen. Für die viermonatige schwere Arbeit zahlte er kein Geld, sondern vergütete die Arbeiter lediglich durch Nahrungsmittel. Die Männer wurden in einer brüchigen Lehmhütte untergebracht – ohne Toilette und Wasseranschluss. Wer gegen diese Zustände protestierte, wurde mit der Waffe bedroht. Für viele brasilianische Zeitungen war es der Aufmacher: Zum ersten Mal wurde ein „moderner“ Sklavenhalter in flagranti ertappt und sofort hinter Gitter gebracht – das gab es noch nie, seit Brasiliens Rückkehr zur Demokratie im Jahre 1985. Vielen erschien das als beachtlicher Fortschritt. Doch nach nur drei Tagen war der betroffene Großgrundbesitzer Max Cangussi wieder frei. „Er wurde lediglich verpflichtet, seinen Sklavenarbeitern den zustehenden Lohn zu zahlen. Kein Prozess, keine Enteignung, wie eigentlich vorgeschrieben“, sagt Antonio Canuto von der kirchlichen Organisation CPT, die solche Fälle immer wieder aufdeckt.
„Seit dem vergangenen Jahr nimmt die Zahl solcher Berichte deutlich zu“, erläutert Canuto. „Auf manchen Farmen wurden von der Bundespolizei bis zu fünf Mal hintereinander Sklavenarbeiter entdeckt.“ Meist ohne Folgen. Vor allem im riesigen Amazonas-Teilstaat Pará regiert laut CPT inzwischen fast völlige Straffreiheit: Bußgelder – umgerechnet etwa 50 Euro für jeden entdeckten Arbeiter – werden nicht bezahlt. Die Polizei, die die Farmen überwachen soll, ist hoffnungslos überfordert. Tausende Fälle von Sklavenarbeit werden vermutet.
Und so funktioniert die Masche der Großgrundbesitzer: Angeworben wird mit falschen Versprechungen und guter Bezahlung. Doch in Wahrheit werden Kosten für Arbeitsgeräte, Transport und Verpflegung vom Lohn abgezogen. Das Leistungspensum setzt der Farmer extrem hoch an. Lebensmittel gibt es nur im Farmladen und zu überhöhten Preisen. Ergebnis: Am Monatsende erhalten die Arbeiter nicht nur kein Geld – man eröffnet ihnen auch noch, dass zuerst die entstandenen Schulden abzutragen seien.