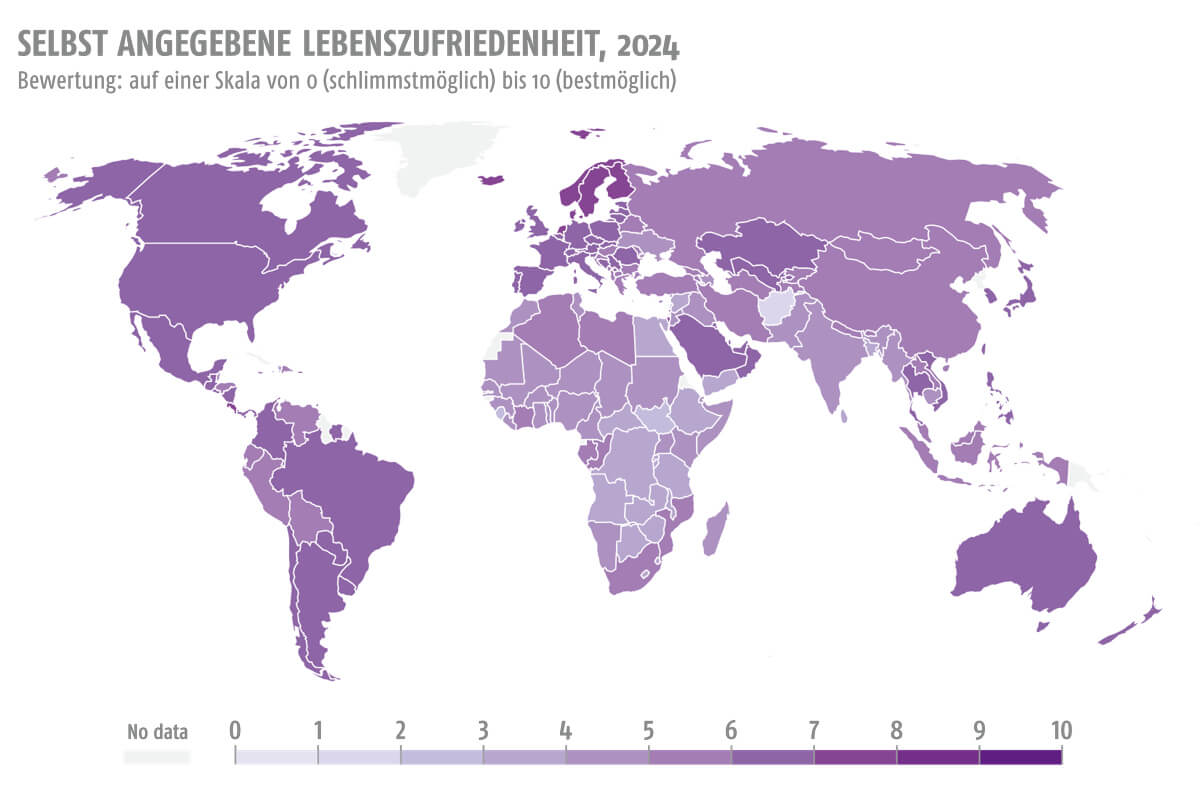
Die Eigenheimpreise schießen durch die Decke. Die Banken schwimmen in Gewinnen aus dem Hypothekengeschäft. Die Mieten sind kaum mehr bezahlbar. Ist es ein Wunder, dass immer mehr Menschen auf der Straße leben? New Internationalist-Autor Wayne Elwood begibt sich auf die Suche nach Strategien gegen die Obdachlosigkeit.
Das Recht auf Wohnen wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) anerkannt, der von 165 Staaten ratifiziert wurde. Mehr als 40 Länder haben ein Dach über dem Kopf zu einem grundlegenden Menschenrecht erklärt. Doch die UNO schätzt, dass weltweit mehr als 1,1 Milliarden Menschen über keine angemessene Unterkunft verfügen und mehr als 100 Millionen überhaupt obdachlos sind. Sie übernachten in Notschlafstellen, in öffentlichen Gebäuden wie Bahnhöfen oder Busterminals, leben auf der Straße oder bauen sich einfache Behausungen aus Abfallmaterial auf ungenutztem Grund. Im Süden leben Millionen Menschen in Elendsvierteln, von Mumbai bis São Paulo. Sie kamen auf der Suche nach Arbeit in die Städte, getrieben von der Armut und Perspektivlosigkeit auf dem Land, die dafür sorgen, dass diese informellen Siedlungen immer weiter wuchern. Sie leben in prekären Unterkünften ohne Mietvertrag, auf Grund, der ihnen nicht gehört, ohne verlässliche Versorgung mit Wasser und Strom und ohne Kanalisation.
Dass sie dort leben können, hängt oft vom guten Willen lokaler Eliten ab. Sie werden toleriert oder ignoriert, bis die Bodenpreise steigen und ihre Siedlungen im Namen der „Entwicklung“ oder der „Slumsanierung“ dem Erdboden gleichgemacht werden.
Seit Jahren bestehende Armenviertel werden abgerissen, um Platz für internationale Sportevents oder Einkaufszentren zu schaffen. Millionen verlieren ihr Heim durch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme oder Erdbeben; andere werden durch den Klimawandel, Bürgerkriege und politische Konflikte zu Vertriebenen.
Das Klischee. Ein „typischer“ Obdachloser im Norden dagegen ist ein alleinstehender, älterer Mann – arbeitslos, von seiner Familie getrennt, sozial isoliert, mit psychischen Problemen, alkohol- oder drogenabhängig. Tatsächlich entsprechen viele Obdachlose diesem Klischee. Doch diese sichtbaren Obdachlosen sind nur die Spitze eines Eisbergs.
Schätzungsweise drei Viertel der obdachlosen Menschen leben nicht auf der Straße. Diese versteckten Obdachlosen, oft Frauen, Jugendliche und Kinder, wohnen in Notunterkünften, bei Verwandten oder Freunden. Wenn Frauen obdachlos werden, ist zumeist Gewalt die Ursache. In einer kanadischen Studie etwa gaben 71 Prozent der betroffenen Frauen an, dass sie Schutz vor Gewalt gesucht hätten.
Ähnliches gilt für Jugendliche und Kinder, die zumeist von Zuhause ausrissen oder dazu gezwungen waren, weil sie misshandelt oder vernachlässigt wurden. Sie sind von der Situation überfordert, von Gefühlen hin- und hergerissen und können sich kaum gegen Ausbeutung wehren. Auf der Straße geraten sie in einen Teufelskreis aus Drogenabhängigkeit, Gewalt und sexuellem Missbrauch.
Die Situation in Kanada hat das Informationszentrum Obdachlosigkeit der York University in Toronto 2013 erhoben: 82 Prozent der obdachlosen Jugendlichen waren Opfer von Straßenkriminalität, mehr als 30 Prozent hatten sexuelle Übergriffe erlebt.
Das neue Prekariat. Es gibt viele Wege in die Obdachlosigkeit, Armut ist jedoch stets ein entscheidender Faktor. Die schwindende Macht der Gewerkschaften, die Angriffe auf den Wohlfahrtsstaat, die Auslagerung der industriellen Produktion, Arbeitslosigkeit und schlecht bezahlte Teilzeit-Jobs haben dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, die steigenden Mieten zu bezahlen. Wer arm ist, kann sich keine angemessene Wohnung leisten.
In den USA müsste man zum Mindestlohn von 7,25 US-Dollar die Stunde – seit 2009 unverändert – 90 Stunden die Woche arbeiten, um sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung leisten zu können, wie die National Low Income Housing Coalition in Washington berechnete.
Ungesicherte Wohnverhältnisse kennzeichnen auch das „neue Prekariat“, ob die so genannten „Working poor“, Familien von AlleinerzieherInnen, Menschen mit Behinderungen, MigrantInnen, Flüchtlinge oder „illegale“ HausbesetzerInnen. Sie leben in der ständigen Gefahr, durch eine Zwangsräumung brutal aus ihrem Lebenszusammenhang gerissen zu werden.
Abwärtsspirale. „Wenn man 60 bis 80 Prozent seines Einkommens für die Miete bezahlt, ist eine Zwangsräumung unvermeidlich“, konstatiert der US-Soziologe Matthew Desmond. Das Resultat: gewachsene Gemeinschaften zerbrechen, und eine Abwärtsspirale der Vernachlässigung setzt ein. In den USA, so Desmond, hat die „Epidemie der Zwangsräumungen“ ein klar erkennbares Gesicht: Betroffen sind vor allem „Mütter und Kinder aus überwiegend von Latinos und Afroamerikanern bewohnten Vierteln, … etwa eine von fünf schwarzen Frauen in den USA erlebt zumindest einmal im Leben eine Zwangsräumung“.
Krisenhafte Ausmaße. Der Mangel an erschwinglichem Wohnraum hat in allen reichen Ländern krisenhafte Ausmaße erreicht. Die Hauptursachen sind die Preishausse auf den Immobilienmärkten, die zunehmende Einkommensungleichheit und eine systematische Vernachlässigung des öffentlichen Wohnbaus. Steigende Obdachlosenzahlen sind die logische Folge.
Der „Markt“ wird das Problem nicht lösen, soviel steht fest. Wird das Menschenrecht auf ein Dach über dem Kopf ignoriert und werden Wohnungen als bloße Ware behandelt, folgt die „Finanzialisierung“ des Wohnungsmarkts auf dem Fuß, wie KritikerInnen sagen: Eine Wohnung ist kein Platz zum Leben mehr, sondern ein Anlageobjekt, das Gewinne abwerfen soll. „Der Wohnbau erfüllt seine gesellschaftliche Funktion nicht mehr“, konstatiert Leilani Farha, UN-Sonderberichterstatterin über das Recht auf Wohnen. Das Ergebnis: „Wohnraum ist leerstehend ebenso wertvoll wie bewohnt, ob man darin lebt oder nicht. Wohnungen stehen leer, während die Obdachlosigkeit rasch zunimmt.“
In den reichen Ländern hat der Höhenflug der Immobilienpreise dafür gesorgt, dass es Familien mit durchschnittlichem Einkommen unmöglich ist, sich ihren Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu erfüllen.
Luxus und Elend. In boomenden Städten wie Sydney, Auckland, Hongkong, San Francisco und Vancouver wimmelt es von luxuriösen Eigentumswohnungen, während Obdachlosenheime überfüllt sind. Institutionen, die kostenloses Essen anbieten, können die Nachfrage nicht mehr decken, das Angebot an erschwinglichen Sozialwohnungen stagniert oder schrumpft sogar.
Die Folgen sind weitreichend. Steigende Mieten und immer höhere Hypotheken verschlingen einen wachsenden Teil der verfügbaren Einkommen. Wenn die Mindestlöhne unter der Armutsgrenze liegen und Sozialleistungen für Einkommensschwache oder Menschen mit Behinderungen unzureichend sind, lässt sich die Miete nur mehr bezahlen, wenn man weniger für Lebensmittel, Mobilität, Kleidung, Gesundheit und die Schule ausgibt.
Viele Metropolen im Norden sind heute von einer physischen Segregation nach ethnischer und sozialer Zugehörigkeit gekennzeichnet, einer Polarisierung zwischen gentrifizierten urbanen Zentren und verstreuten Armutsvierteln, in denen Menschen mit geringem Einkommen, MigrantInnen, Flüchtlinge und diskriminierte Minderheiten gerade noch bezahlbare Unterkünfte finden.
Genau das Gegenteil hatte die berühmte kanadische Stadt- und Architekturkritikerin Jane Jacobs (1916-2006) gefordert: Innerstädtische Gebiete benötigten eine kulturelle und soziale Vielfalt, um attraktiv und lebenswert zu sein, und es brauche eine bestimmte Bevölkerungsdichte und Vielfalt, um ein lebendiges Straßenbild und „Augen auf der Straße“ zu schaffen, wie es Jacobs ausdrückte. Stattdessen sind unsere urbanen Zentren zunehmend sozial stratifiziert – die Ungleichheit manifestiert sich geographisch.
Rückzug der öffentlichen Hand. Nach dem Kollaps der Immobilienmärkte haben sich viele Regierungen vom Wohnbau verabschiedet und gleichzeitig den Rotstift bei den Sozialleistungen und der Arbeitslosenhilfe angesetzt.

Schon vor dreißig Jahren hatte Margaret Thatcher ihre Austeritätsideologie in Großbritannien durchgesetzt und einen Feldzug gegen den staatlichen Einfluss in der Wirtschaft begonnen. 1980 wurde die „Right to Buy“-Politik eingeführt: Wohnungen in öffentlichem Eigentum konnten von ihren BewohnerInnen zu weit unter dem Marktwert liegenden Preisen erworben werden. Seither wurden mehr als 1,8 Millionen dieser Wohnungen mehr oder weniger verschleudert. Weniger als zehn Prozent davon wurden durch Neubauten ersetzt, was den Bestand an leistbarem Wohnraum auf einen Bruchteil reduziert hat. Und es geht weiter so: Zwischen April 2012 und November 2015 wurden mehr als 40.600 Sozialwohnungen verkauft, während nur 3.694 gebaut wurden. Gleichzeitig wurden die Ausgaben für Wohnbeihilfen um mehr als fünf Mrd. Pfund (ca. 5,6 Mrd. Euro) verringert und die Mittel für die Betreuung von Obdachlosen um 45 Prozent gekürzt.
Dass die Zahl der Obdachlosen im Vereinigten Königreich rasch zugenommen hat, ist insofern nicht überraschend. Die britische Wohlfahrtsorganisation Shelter schätzt die Zahl der Obdachlosen auf mehr als 250.000.
Identische Entwicklungen sind überall dort festzustellen, wo die Politik auf den „Markt“ setzte. In den USA sanken die Ausgaben für Sozialwohnungen zwischen 1980 und 2003 um die Hälfte. Familien, die sich gerade noch über Wasser halten, stecken in einem Teufelskreis der Armut. Nur ein Viertel der US-Haushalte, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, bekommt auch eine zugewiesen. Im Bundesdistrikt Washington muss man derzeit mehr als 20 Jahre darauf warten. Obdachlosigkeit ist tödlich im wahrsten Sinn des Wortes. Laut einer Studie der britischen Wohlfahrtsorganisation Crisis von 2011 liegt die Lebenserwartung Obdachloser um 30 Jahre unter dem nationalen Durchschnitt. Ihre Selbstmordrate ist neunmal höher, und ihr Risiko, an einer Infektionskrankheit zu sterben, zweimal so hoch. In der kanadischen Provinz British Columbia ist die Lebenserwartung Obdachloser nur halb so hoch wie die der übrigen Bevölkerung.
Durch Obdachlosigkeit werden nicht nur Leben zerstört, sie ist auch teuer. Es ist billiger, Obdachlosen eine Unterkunft zu verschaffen als sie mit ihrem Problem allein zu lassen. Die „Central Florida Commission on Homelessness“ stellte fest, dass Floridas SteuerzahlerInnen für jede ständig obdachlose Person im Schnitt 31.000 Dollar jährlich berappen – für Transportkosten, Krankenhausbesuche, Polizeieinsätze und Gefängnisaufenthalte. Dagegen würde es bloß 10.000 Dollar im Jahr kosten, ihnen eine feste Wohnung, Berufsausbildung und Gesundheitsversorgung bereitzustellen.
Für die meisten Menschen, die mit Obdachlosen arbeiten, ist das nichts Neues. Obdachlosigkeit begünstigt eine breite Palette sozialer Pathologien. Dazu gehören schlechte Ausbildung, Diskriminierung, Suchtverhalten, Kriminalität, Gewalt in Beziehungen und psychische Störungen. Kinder, die in Obdachlosigkeit aufwachsen, haben Probleme in der Schule und leiden unter Verhaltensstörungen. Als Erwachsene leben sie oft in Armut.
Obdachlosigkeit hat viele Ursachen, die sich sowohl im politischen wie im privaten Bereich verorten lassen. An erster Stelle jedoch steht die Armut. Arbeit ist schwer zu finden, und was es gibt, ist schlecht bezahlt und unsicher. Das soziale Netz ist löchrig und die Sozialbudgets sind zu knapp, um mit den steigenden Wohnkosten Schritt zu halten. Nicht zuletzt spielen auch psychologische Faktoren eine Rolle: Menschen unter existenziellem Stress sind weniger in der Lage, mit plötzlichen Veränderungen zurechtzukommen. Schon der geringste Misserfolg – der Verlust eines Einkommens oder ein Krach in der Familie – kann ausreichen, um sie aus der Bahn zu werfen.
Wenn eine Strategie gegen Obdachlosigkeit Erfolg haben soll, muss sie an allen diesen Ursachen gleichzeitig ansetzen. Und wir müssen auch begreifen, dass eine eigene Wohnung mehr ist als bloß ein Dach über dem Kopf: Stabile Wohnverhältnisse sind nicht nur die Basis für stabile Gemeinschaften, eine Wohnung ist auch ein Anker für die Seele, ein Platz, an dem wir unser Leben leben können.
Copyright New Internationalist







