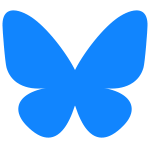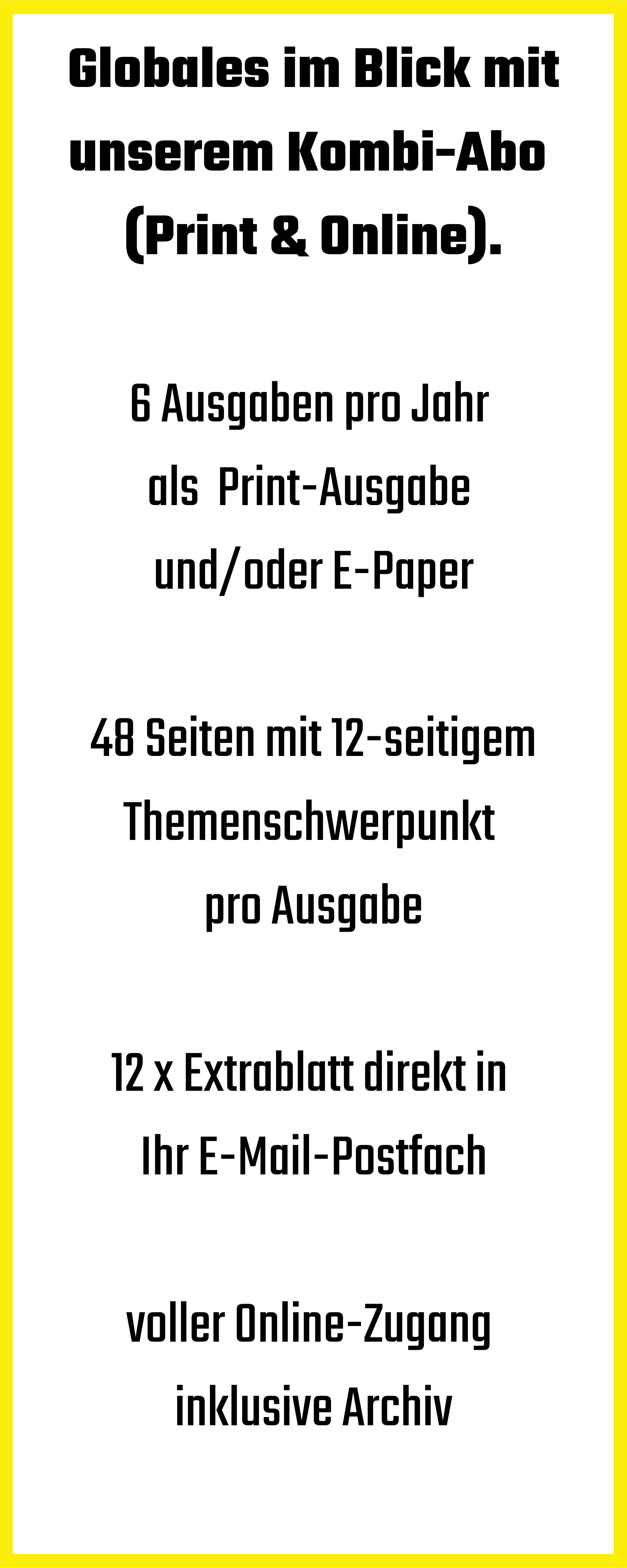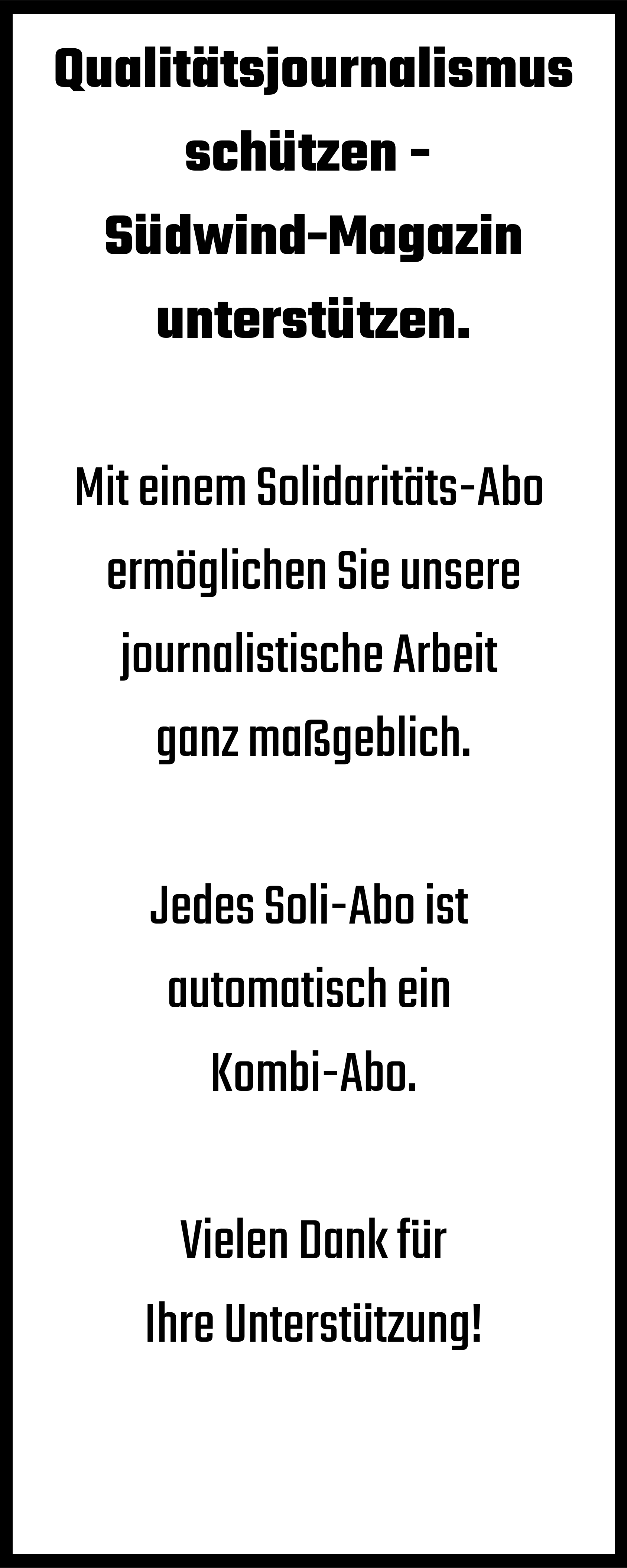Kolumbiens zarte Pflänzchen

Hinweis der Redaktion: Hören Sie sich diesen Artikel als Audioversion an. In unserem hektischen Alltag bleibt oft kaum Zeit zum Lesen – darum arbeiten wir an einem neuen Angebot: einer Hörvariante unserer Artikel. Chefredakteurin Christine Tragler hat den Text von Tobias Lambert für Sie im Tonstudio eingelesen. Hören Sie rein!
Als eine der wenigen weltweit versucht die Regierung, Agrarland gerechter zu verteilen. Dabei geht sie einer direkten Konfrontation mit den Großgrundbesitzenden aus dem Weg, um den frisch gesäten Frieden nicht zu gefährden.
Ein Prozent der Landbesitzer:innen kontrollieren mehr als 80 Prozent der Agrarfläche Kolumbiens. Die aktuellsten Zahlen, die historische Ungleichverteilung belegen, stammen aus dem Jahr 2014. Um dies endlich zu ändern, ging auch Gustavo Petro, erster linker kolumbianischer Präsident, bis dato zaghaft vor. Denn: Der ungleiche Zugang zu Land galt als Hauptursache für den jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt, bei dem sich linke Guerillagruppen auf der einen und Militär sowie Paramilitärs auf der anderen Seite bekämpften.
Als Petro im Oktober 2022, damals frisch gewählt, eine Länderei des früheren Paramilitärchefs Carlos Castaño feierlich an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern übergab, läutete er offiziell den Beginn einer neuerlichen Agrarreform ein. Auf dem Papier bestand sie bereits, wurde aber von den Vorgängerregierungen kaum umgesetzt. Die effektive Umverteilung von Land ist eine Frage der Gerechtigkeit, sowohl für die kleinbäuerlichen Bewegungen als auch für die erste Mitte-Links-Regierung in der Geschichte Kolumbiens.
Klein gegen groß. Trotz zahlreicher Versuche im 20. Jahrhundert, Agrarreformen durchzuführen, wurden Fortschritte immer wieder durch Gegenreformen zurückgenommen. Großgrundbesitzende stellen seit jeher eine politisch einflussreiche Gruppe dar. Ihre Ländereien verteidigten sie teils mit Gewalt, unterstützt von paramilitärischen Gruppen. Dabei vertrieben sie die kleinbäuerliche Bevölkerung aus zahlreichen Regionen – insgesamt eine Fläche von schätzungsweise acht bis zehn Millionen Hektar, größer als Österreich. Die Großgrundbesitzenden bauten darauf Cash Crops wie Ölpalmen, Zuckerrohr, Bananen, Blumen oder Kaffee für den Weltmarkt. Sie trugen so zur Etablierung einer exportorientierten Landwirtschaft bei.
1994 konnten kleinbäuerliche Bewegungen im Zuge einer Gesetzesreform durchsetzen, dass Kleinbäuerliche Schutzzonen (ZRC) eingerichtet werden, in denen privater Landverkauf begrenzt wird. Aber: Bis 2002 entstanden lediglich sechs ZRC, zusammengerechnet nur etwas größer als Salzburg. Der Staat sah darin Rückzugsgebiete für Guerillagruppen, und so kamen kaum weitere hinzu.
Indes führten die neoliberalen Regierungen bis 1998 eine von der Weltbank propagierte „marktgestützte Landreform“ durch: Der Staat subventionierte den Kauf von Böden mit bis zu 70 Prozent der Summe. Die übrigen 30 Prozent mussten Interessent:innen selbst oder über Kredite finanzieren. Das Interesse potentieller Käufer:innen war bescheiden. Nur rund 180.000 Hektar wurden Gegenstand dieser „Reform“. Die guten Böden standen derweil gar nicht zum Verkauf.
Kolumbien
Hauptstadt: Bogotá
Fläche: 1,14 Millionen km2
Einwohner:innen: 48 Millionen (2018 letzter Zensus, Schätzung 2024: 53 Mio.)
Human Development Index (HDI): Rang 91 von 193 (Österreich 22)
BIP pro Kopf: 6.947 US-Dollar (2023, Österreich: 56.033 US-Dollar)
Regierungssystem: Präsidentielle Demokratie, Staats- und Regierungschef ist seit August 2022 Gustavo Petro.
Land und Frieden. Erst 2016 setzte das Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung unter Juan Manuel Santos und der größten Guerilla FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens), die marxistisch orientiert war und sich für eine Landreform einsetzte, das Thema wieder auf die Tagesordnung.
Bis 2028 sollen demnach zehn Millionen Hektar umverteilt und formalisiert werden. Auch sieht das Abkommen staatliche Programme zur Unterstützung einer kleinbäuerlichen und nachhaltigen Landwirtschaft vor. Einer der Pfeiler darin ist ein Landfonds, der drei Millionen Hektar Land, das größtenteils in der Vergangenheit illegal erworben oder besetzt wurde, umfassen und dann neu verteilen soll.
Koka ade? Ein weiteres Ziel: den Anbau von Kokapflanzen zurückzudrängen. Bis dato können Kleinbäuerinnen und Kleinbauern damit deutlich mehr verdienen als durch den Anbau von Lebensmitteln. Mittels Substitutionsprogrammen soll sich das ändern. Kriminellen Banden, Paramilitärs und Guerillas, die sich seit jeher auch aus den Erträgen des Drogenhandels finanzierten, würde damit die Einkommensquelle abgegraben werden.
Was auf dem Papier fortschrittlich klingt, krankte zunächst jedoch an der schleppenden Umsetzung. Santos‘ Nachfolger Iván Duque (2018-2022) machte nie einen Hehl daraus, dass er das Friedensabkommen ablehnte. Zudem blieb in Kolumbien auch nach dem Friedensschluss ein sehr gewalttätiges Umfeld bestehen. Laut dem kolumbianischen Institut für Friedens- und Entwicklungsstudien wurden seit 2016 mehr als 1.700 Aktivist:innen und Menschenrechtsverteidiger:innen sowie 439 ehemalige FARC-Kämpfer:innen im Land ermordet.
Beste Böden. Für einen dauerhaften Frieden bleibt eine gerechtere Verteilung des Bodens notwendig. Doch die Umsetzung innerhalb der bestehenden institutionellen und rechtlichen Möglichkeiten geht nur langsam voran. Von den bis Ende 2024 schließlich 18 eingerichteten Schutzzonen etwa, wurden elf während der aktuellen Regierung neu ausgewiesen.
Einen der historisch mächtigsten Gegner einer Landreform konnte die Regierung unter Petro zur Abtretung von Land bewegen: Mit der Viehzüchtervereinigung Fedegán, die in enger Verbindung zu paramilitärischen Gruppen stand, einigte sie sich darauf, dass diese dem Staat drei Millionen Hektar Weideland zu Marktpreisen verkauft, die im Anschluss an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verteilt werden. Für die Landbesitzer:innen ist der Deal ein gutes Geschäft, weil sie die besten Böden erneut für sich behalten können.
Weiter Weg. „Trotz der Anstrengungen dieser Regierung, ist der Weg der Agrarreform noch weit“, räumte Petro selbst ein. Laut offiziellen Angaben wurden Ende 2024 erst 166.000 Hektar zur Umverteilung aufgekauft und 1,2 Millionen Hektar kleinbäuerlichen Landbesitzes mit Besitztiteln versehen. Anfang dieses Jahres kündigte die Regierung an, den Prozess beschleunigen zu wollen. 2025 müsse „das Jahr der Agrarreform“ werden. Da sie das Land befrieden will und eine Umverteilung Eskalationspotenzial mit sich bringt, wandelt sie bei dem Thema weiterhin auf einem schmalen Grat. Die bisher vorgesehene Verteilung und Formalisierung von Landbesitz stellt weder eine Abkehr von exportorientierter Plantagenwirtschaft noch eine Zuwendung zu agrarökologischen Ansätzen in Aussicht. Dennoch: Der eingeschlagene Kurs kann als erster Schritt und Grundlage für weitere dienen.
Tobias Lambert lebt in Berlin und arbeitet als freier Autor, Redakteur und Übersetzer überwiegend zu Lateinamerika.