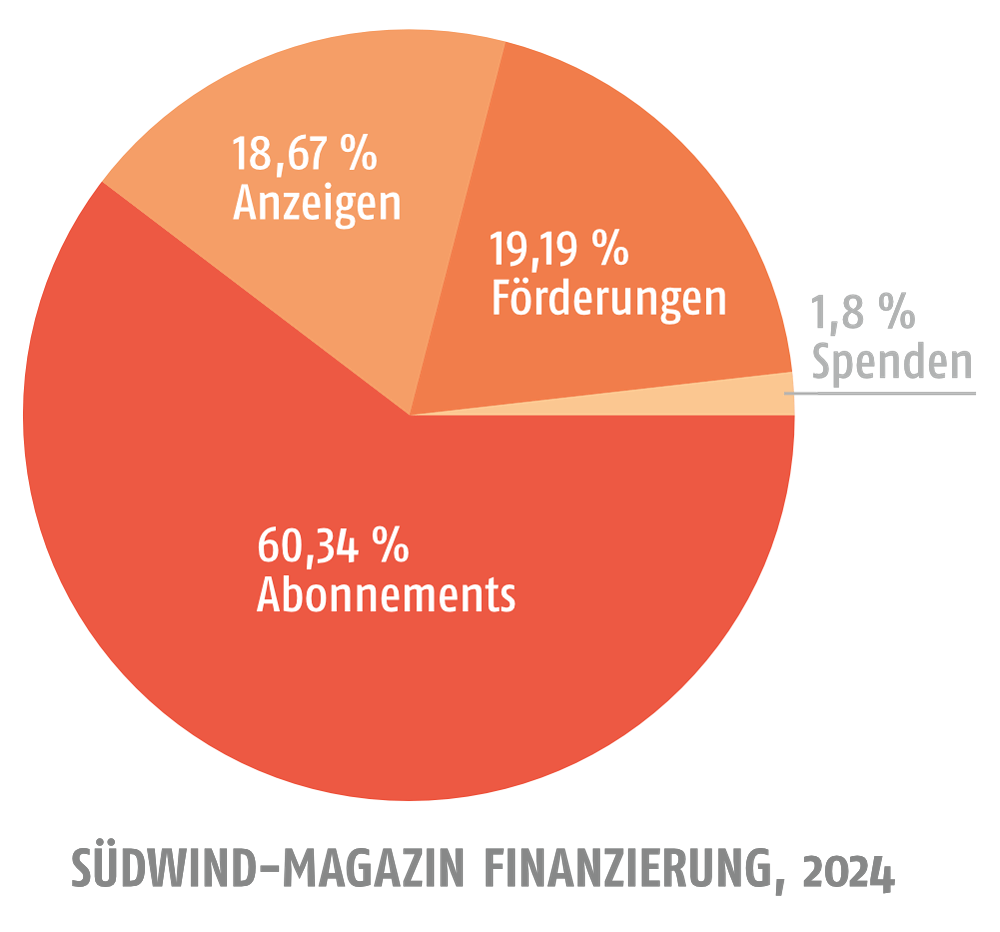In Mexiko machen die Frauen der zapatistischen Befreiungsbewegung die Widersprüche einer multikulturellen „feministischen“ Bewegung deutlich.
Natürlich kämpfen wir gegen die Ungleichheit von Mann und Frau, aber ich bin doch keine Feministin! Natürlich werden wir Frauen hier ausgebeutet und haben weniger Rechte als die Männer, und wir sind uns dessen bewusst und lassen uns das nicht gefallen. Aber ich wiederhole: wir sind keine Feministinnen.“ So Tilita Rodríguez, Mitarbeiterin des Vereins Indigene Frauen und ihre Rechte, 26 Jahre jung, Alleinerzieherin, Maya-Indianerin.
An Tilitas Aussage kann exemplarisch die Vielschichtigkeit eines mexikanischen, mehrheitlich weißen und mestizo- „Feminismus“ abgelesen werden, der bislang einseitig die Rechte der „Frau“ ohne Rücksichtnahme auf „Rasse“ und Klasse“ eingefordert hatte.
„Für uns Indianerinnen hat Feminismus mit einer Realität zu tun, die nicht die unsrige ist. Das ist ein Wort für die Frauen in der Stadt und die Frauen einer ganz anderen Schicht, die in einer anderen Welt leben und sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert sehen. Unsere Ziele sind auch teilweise nicht die gleichen, manchmal schaden die von den Bürgerlichen entworfenen Forderungen uns mehr, als dass sie uns nützen.“ Tilita bringt ein grundsätzliches Problem des Kampfes der Frauen um Gleichberechtigung in einer so stark stratifizierten Gesellschaft wie der mexikanischen auf den Punkt: Es gibt viele Feminismen, und die können durchaus von Rassismus und internem Kolonialismus geprägt sein. Denn Frau ist eben nicht gleich Frau, und Indianerinnen haben es jetzt satt, innerhalb der Frauenbewegung in Mexiko unter dem „exotisch Anderen“ subsumiert zu werden, ihre Forderungen einfach vom Tisch gekehrt zu sehen und weiterhin den bürgerlichen Frauen als Haushaltsgehilfinnen zur Verfügung zu stehen und somit deren Karriere zu ermöglichen.
Es vergingen rund 40 Jahre, bis sich ein indigenes, dezidiert geschlechtsspezifisches Bewusstsein in Mexiko zu zeigen begann. Kam es in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkt innerhalb der gerade erst organisierten indigenen Bewegungen zur Infragestellung einer homogenen mestizischen Nation, zu Forderungen nach Land, Demokratie, nach kulturellen Rechten der Indianer, waren indigene Frauen zwar präsent, doch nur im Hintergrund: „Wir waren die Begleiterinnen auf den Veranstaltungen, wir haben uns um ihren Ablauf gekümmert, doch hatten wir nie die Chance, Entscheidungsträgerinnen zu werden“, erinnert sich die Tzotzil-Indianerin Camelia, die 1974 an dem mittlerweile historischen „Indigenen Kongress“ in Chiapas teilnahm und dort zumindest die Möglichkeit zur Vernetzung mit Indianerinnen aus anderen Teilen Mexikos nutzte.
Nicht nur die durch den Erdölboom der 70er Jahre erzeugten veränderten Anforderungen an Frauen, auch die katholische Kirche trug zur Diskussion über Ungleichheit zwischen Mann und Frau innerhalb der indigenen Gemeinschaften bei. In San Cristóbal de las Casas entstand darum Ende der 80er Jahre aus einer Kirchenvereinigung heraus die Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), die erste indigene Frauenorganisation in Chiapas.
Diese einzelnen Schritte waren die notwendige Voraussetzung für das von den zapatistischen Frauen 1994 entworfene Gesetz Ley Revolucionaria de Mujeres, dem ersten, das dezidiert auf die Bedürfnisse der indigenen Frauen zugeschnitten ist und an dem sich auch die Differenzen zu einem urbanen Feminismus offen zeigen. „Man kritisierte uns beispielsweise für das im Gesetz verankerte Verbot der Untreue, man bezeichnete es als katholisch reaktionär, mag sein, doch wir, denen aus der ‚Tradition‘ unserer Kultur heraus Nachteile gegenüber den Männern erwachsen, müssen uns eben anders als unsere Kolleginnen schützen.“
Somit stellt der aktuelle indigene Feminismus das beliebte Zurückgreifen der indigenen Bewegungen auf „Tradition“ in Frage, denn oft würde die Lektüre der Vergangenheit einer ehemals autochtonen Kultur aus einer sexistischen Perspektive erfolgen und in der Gegenwart als Strategie in der Legitimation des Ausschlusses der Frau benutzt werden. Der Kampf ist also an beiden Fronten eröffnet, und das Ziel ganz klar: „aus der Differenz heraus unseren eigenen Weg zu gehen, und dann die Kontakte zu den anderen Frauenbewegungen zu suchen. Denn auch sie können einiges von uns lernen.“ Und europäische Feministinnen ebenso.
Erika Müller war Forscherin und Lehrbeauftragte an der Universität von Quintana Roo in Mexiko und lebt zur Zeit als freie Journalistin in Wien.