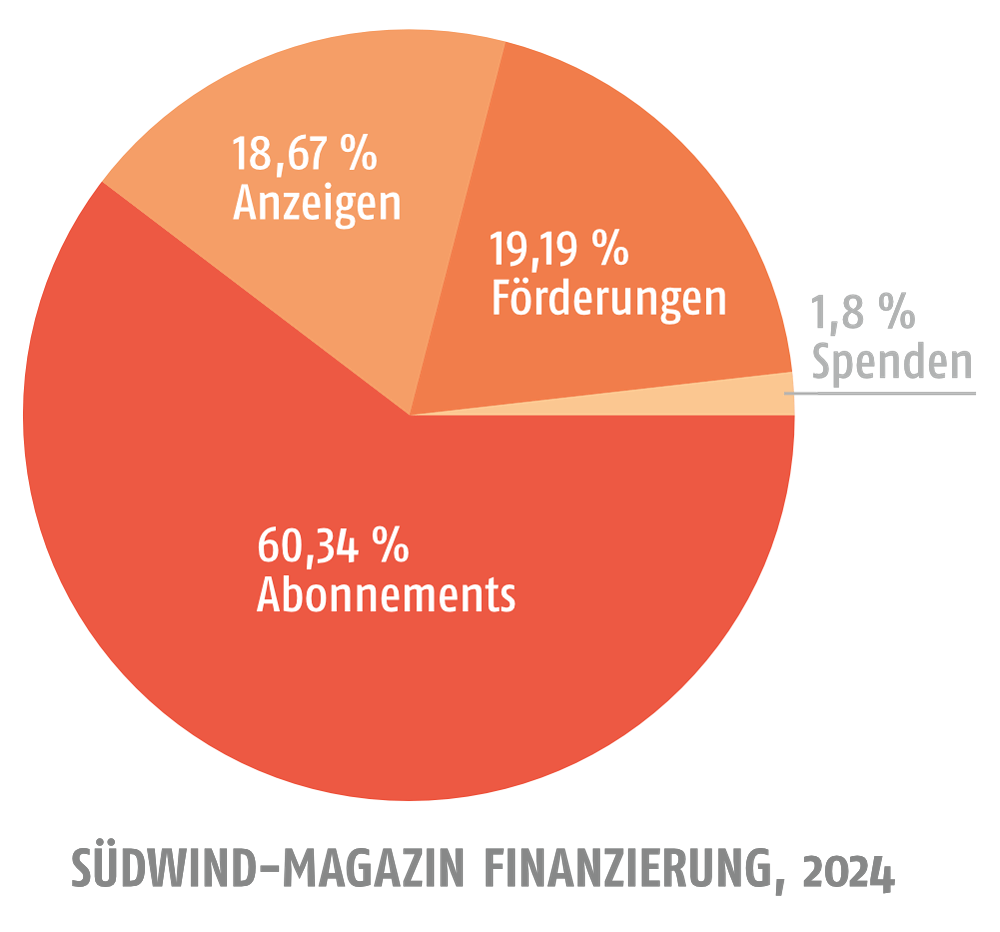Während Simbabwe, Malawi, Mosambik, Lesotho und Swasiland genmanipulierten Mais in gemahlenem Zustand akzeptieren, weigert sich Sambia weiterhin strikt, die Hilfslieferungen aus den USA anzunehmen.
Sack für Sack gehen die Vorräte zur Neige. Die begehrten Maiskörner rinnen in alte Behälter und Plastiktüten. Voller Verzweiflung warten Menschen auf ihre Ration. Hungernde Mägen werden in Sambia mit den letzten Lieferungen der internationalen Hilfsorganisationen gefüllt. Maisbrei kann in einigen Haushalten als notdürftige Mahlzeit über das Schlimmste hinwegretten. Wie lange noch, ist klar zu berechnen: Das Welternährungsprogramm hat die restlichen 7.000 Tonnen nichtbehandelten Mais an die Armen fast vollständig verteilt – allerdings stapeln sich noch 14.000 Tonnen Genmais in den örtlichen Lagern der UN-Hilfsorganisation. Sie dürfen nicht angerührt werden – bis die sambische Regierung möglicherweise ihre Entscheidung rückgängig macht, keinen manipulierten Mais von Spendern zu akzeptieren. „Wir mögen arm sein und keine Nahrung haben, aber wir werden unser Volk nicht diesem Risiko aussetzen“, hatte Sambias Präsident Levy Mwanawasa im Brustton der Überzeugung während des Weltgipfels über nachhaltige Entwicklung in Johannesburg verkündet. Das „Gift“ will er nicht zulassen. SambierInnen sollten nicht als Versuchskaninchen missbraucht werden, denn niemand könne ihm garantieren, dass der gentechnisch behandelte Mais keine gesundheitlichen Schäden anrichte.
Nach Schätzungen von UN-Organisationen sind zum Jahresende 14,4 Millionen Menschen akut vom Hunger bedroht. In Sambia hungern derzeit rund zwei Millionen Menschen, und bis zur nächsten Ernte im kommenden März werden 224.000 Tonnen Nahrung benötigt. „Es ist eine Angelegenheit von Leben und Tod“, sagt Judith Lewis, Regionaldirektorin des Welternährungsprogramms (WFP). Doch Lewis räumt auch ein, dass es Alternativen zum genmanipulierten Mais aus den USA gibt. So hat das WFP inzwischen weitere 12.000 Tonnen gelben, nichtbehandelten Mais aus Südafrika importiert und damit für weitere Wochen die Hilfsnahrung gesichert. US-BürgerInnen verzehren seit sieben Jahren Genmais. Das Welternährungsprogramm vertritt den Standpunkt, der gelieferte Mais sei „sicher“ und habe vor der Verschiffung nach Afrika alle Kontrollbestimmungen durchlaufen, die im Land routinemäßig durchgeführt werden.
Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Welternährungsorganisation (FAO) sehen keinen Anlass zur Besorgnis. „Auch nach Jahren des Verzehrs gibt es keine Beweise für gesundheitliche Schäden“, erklärt FAO-Mitarbeiter Nick Parsons. BefürworterInnen weisen darauf hin, dass in den von der Hungerkatastrophe betroffenen Ländern Sambia, Simbabwe, Malawi, Mosambik, Lesotho und Swasiland seit Jahren Genmais verteilt und akzeptiert worden war. Doch jetzt verweigert Sambia als einziges Land die Annahme der Lieferungen – doch an Flüchtlinge aus Angola und Kongo in Sambia wird genmanipulierter Mais verteilt.
Präsident Levy Mwanawasa hat kürzlich ein Team von WissenschaftlerInnen in die Vereinigten Staaten und nach Europa gesandt, um Informationen über den Stand der Gentechnologie zu sammeln. Hilfswerke erwarten die WissenschaftlerInnen jeden Tag zurück in der Hoffnung, mitgebrachte Erkenntnisse würden die Regierung umstimmen.
Simbabwe – dort werden 6,7 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung zum Jahresende hungern – hatte zunächst Genmais abgelehnt und später eingelenkt. Alle übrigen fünf Länder haben sich entschieden, den Mais vor dem Verbrauch mahlen zu lassen (siehe Artikel von Hermann Klosius, S. 14-16). „Wir müssen jetzt auch Mühlen in der Region überprüfen, denn sie sollten zwei Mahlverfahren für Genmais und nichtbehandeltes Korn bieten, damit keine Vermischungen entstehen“, sagt WFP-Regionaldirektorin Lewis.
Genmanipuliertes Saatgut ist ein strittiges Thema in Afrika. Während die einen diese Art von Nahrung als Lösung für das Problem des Welthungers bezeichnen, sehen andere die Interessen von profitorientierten multinationalen Konzernen im Vordergrund, die auf den afrikanischen Markt drängen. Lokale und internationale Lobbygruppen befürchten ein wirtschaftliches und politisches Machtspiel: Wenn Saatgutfirmen einmal den Eintritt in Entwicklungsländer gesichert haben, werde der traditionelle Anbau und der lokale Markt zerstört und die afrikanische Kleinbauernschaft abhängig von multinationalen Konzernen. Es gehe den Firmen um ihren Profit, nicht um die Rettung vor dem Hungertod.
Die kenianische Wissenschaftlerin Florence Wambugu leitet ein Büro der „A Harvest Biotech Foundation“ in Nairobi sowie in Johannesburg. Diese setzt sich für Biotechnologien in Afrika – zur Bekämpfung des Hungers – ein. Sie sieht naturgemäß überhaupt keine Gefahr, dass internationale Saatgut-Konzerne die afrikanischen Länder überrennen könnten. „Afrika ist artenreich, besitzt aber zu wenig technische Möglichkeiten, diese Vielfalt zu nutzen.“ Nach ihrer Meinung seien viele afrikanische Länder der Gentechnologie gegenüber positiv eingestellt; zum Beispiel Südafrika und Nigeria würden kräftig investieren und hätten gesetzliche Regelungen zur Biotechnologie verabschiedet. In Südafrika wüchsen behandelte Baumwoll- und Maispflanzen.
Südafrikas Wissenschaftsminister Ben Ngubane: „Diese Technologie ebnet den Weg zur Industrialisierung und Afrika wird davon ausgeschlossen bleiben, wenn wir nicht handeln.“ Die meisten anderen Länder des südlichen Afrika jedoch seien, was Kontrollmechanismen und geplante Sicherheitssprotokolle zur Biotechnologie betrifft, nicht auf dem neuesten Stand. Sie würden sich auf Informationen aus den Industrieländern verlassen und auch kaum Kapazitäten besitzen, Richtlinien zur Umsetzung von Biotechnologie zu befolgen. „Wenn afrikanische Länder keine entsprechenden Regulierungen einführen können, besteht die Gefahr, die durch Biotechnologie möglichen Vorteile zu verpassen“, meint Jennifer Thomson, Professorin für Molekularbiologie an der Universität Kapstadt.
Bei den Hungernden selbst ist die Diskussion um Gen-Nahrung in Sambia auch präsent. In Dörfern hören sie im Radio, das giftige Zeug komme für sie nicht in Frage. Aber die Zeit drängt und für die Armen gibt es kaum Alternativen zum Überleben. Einbrüche in die Vorratslager in den Gegenden, in denen die Säcke mit Genmais auf die Verteilung warten, sind nicht selten, berichten WFP-MitarbeiterInnen. Die Menschen werden vom Hunger getrieben, und da ist es ihnen scheinbar egal, ob die Körner genmanipuliert sind oder nicht.
Martina Schwikowski ist Afrika-Korrespondentin der taz und lebt in Johannesburg/Südafrika.