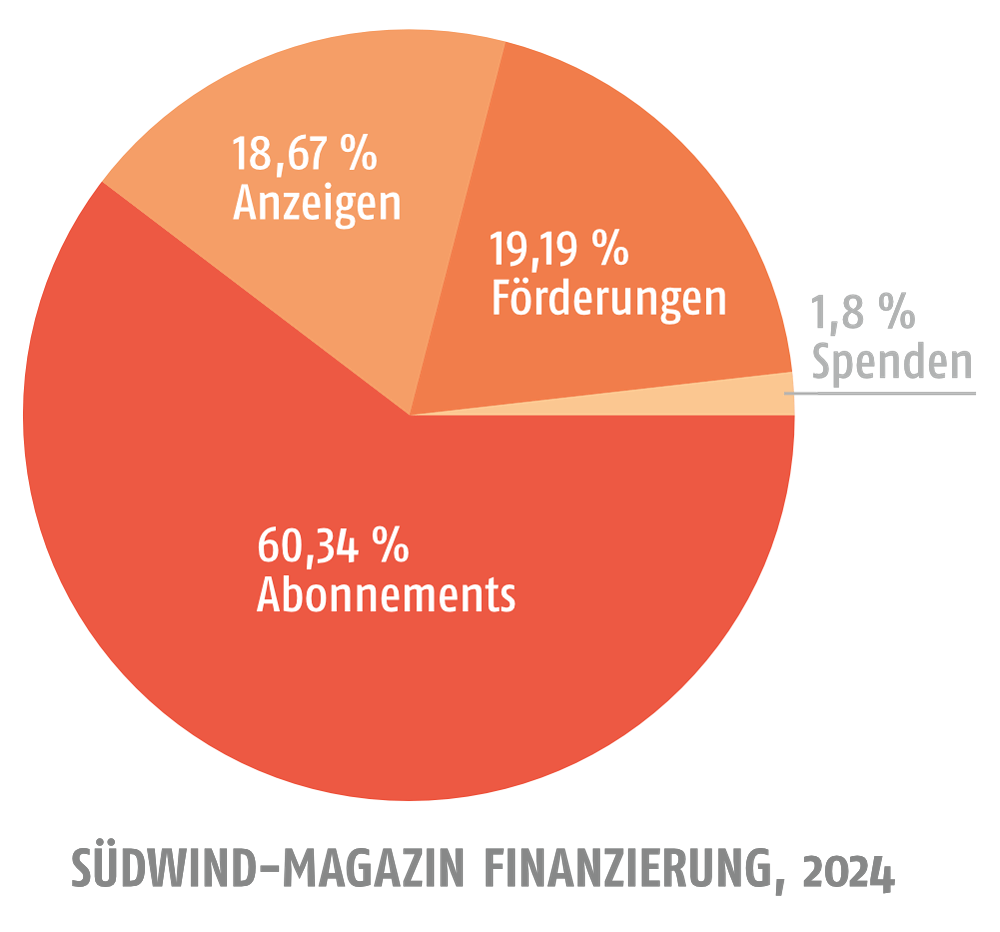Wie MigrantInnen aus Mali ihren Heimatort unterstützen, hat sich Bettina Rühl angesehen.
Nachts liegt Bassirou Bane manchmal wach, obwohl sein Leben eigentlich rund läuft: Der etwa 60-Jährige ist ein erfolgreicher Händler in Koniakary, einem Ort im äußersten Westen von Mali. Gleichzeitig ist er auch Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, seit in Mali 1999 im Zuge der Dezentralisierung Kommunen entstanden. Seitdem wurde er nach Ablauf seiner Amtszeit jedes Mal wiedergewählt. Wenn er durch Koniakarys quirlige Straßen geht, grüßen ihn die Menschen mit Wärme und Respekt. Auch privat scheint alles zum Besten zu sein. Vor kurzem hat Bane eine zweite Frau geheiratet, die Geburt ihres ersten Kindes steht kurz bevor.
Was ihm trotz allem manchmal den Schlaf raubt, sind die Bilder von überfüllten und kaum seetüchtigen Booten auf dem Mittelmeer, die ihm der Fernseher abends ins Wohnzimmer bringt. „Ich finde es schockierend zu sehen, wie sich junge Menschen in diese Schlauchboote quetschen und ihr Leben riskieren“, sagt Bane. Jedes Mal sucht er, ob er ein bekanntes Gesicht entdeckt. Bislang war er stets erleichtert, weil er nur Unbekannte sah.
Koniakary gehört zu den Kommunen in Mali, aus denen besonders viele Menschen auf der Suche nach Arbeit ins Ausland gehen. Das gilt seit Generationen für die gesamte Region rund um die Provinzmetropole Kayes im Westen des Landes.
„Früher gingen die Männer jedes Jahr für ein paar Monate in die Nachbarländer“, erzählt Bane, ein schlanker Mann mit aufmerksamem Blick. „Zur Regenzeit kamen sie aus Senegal oder Elfenbeinküste nach Hause zurück und halfen hier bei der Ernte.“ Anschließend seien sie wieder losgezogen.
Mit dem Beginn der Erdölförderung und des Bergbaues wurden auch zentralafrikanische Länder für die malischen ArbeitsmigrantInnen attraktiv. „Vor allem dort haben die Menschen aus unserer Gegend als Händler ein Vermögen verdient“, erzählt Bane.
Von Europa habe damals kaum jemand geträumt. Das Glück lag näher. Es sei einfacher zu haben und nicht mit einem Kulturschock zu bezahlen gewesen. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Nach Banes Schätzungen arbeiten von den rund 15.000 BewohnerInnen des Ortes 15 Prozent im Ausland, nur ein Drittel davon in Europa.
Leere Versprechungen. Weil der Weg nach Europa weiter und schwieriger ist als in die Nachbarländer, wurde das Sterben in der Wüste Sahara und auf dem Mittelmeer zu einem festen Bestandteil der Migration Richtung Norden. „Nach jedem Bootsunglück hören wir die gleichen Sonntagsreden von Politikern, die solche Dramen angeblich stoppen wollen“, erregt sich Bane. „Aber von dem Geld, das Europa seit Monaten für diesen Zweck verspricht, sehen wir hier vor Ort bisher nichts.“ Das ärgert ihn, aber gleichzeitig ist er kein Gegner der Migration.

Natürlich will er das Sterben beenden, aber insgesamt sei das „eine komplexe Angelegenheit“, wie der Bürgermeister meint. „Für unsere Gemeinde und viele Familien wäre ein Ende der Migration die reine Katastrophe.“
Um zu zeigen was er meint, lädt er zu einem Rundgang durch den Ort ein. Seine Tour beginnt noch vor dem Losgehen, nämlich im Rathaus. Das wurde schon 1978 gebaut, damals noch als Außenstelle des Standesamtes, „weil wir es leid waren, für jedes Dokument stundenlang fahren zu müssen“. Und weil die malische Regierung keinerlei Anstalten gemacht habe, sich um die Anliegen ihrer BürgerInnen zu kümmern. Die Bevölkerung von Koniakary nahm ihre Geschicke Anfang der 1970er Jahre selbst in die Hand, durchaus enttäuscht von der jungen malischen Demokratie.
Neue PartnerInnen. Da die malische Regierung nicht mehr für sie tat als früher die französische Kolonialmacht, nahmen die Dorfältesten 1972 Kontakt mit denjenigen auf, die ihr Geld im Ausland verdienten, damals noch ausschließlich in afrikanischen Ländern. So begann eine Entwicklungszusammenarbeit, die bis heute anhält: Die MigrantInnen schicken das Geld, die Bevölkerung von Koniakary macht die Arbeit.
Bane zeigt das Gesundheitszentrum, das MigrantInnen und Ansässige als erstes gemeinsam in Angriff nahmen. Zur Einweihung kam sogar die First Lady des damaligen Präsidenten Moussa Traoré, denn in der ganzen Region gab es nichts Vergleichbares.
„Bezahlt haben das alles unsere Migranten“, sagt Saidou Bane stolz, der in einem grünen Kittel dazukommt. Der warmherzig wirkende Mann ist der Vorsitzende des Vereins, der das Gesundheitszentrum verwaltet. Saidou Bane hat selbst jahrzehntelang in Gabun als Händler viel Geld verdient, bis er vor acht Jahren nach Hause zurückkam, „weil einige zu Hause die Fäden zusammenhalten müssen“. Seitdem bestellt er seinen Acker und verwaltet ehrenamtlich das Gesundheitszentrum. Von seinen sechs Kindern sind drei noch in der Schule, drei arbeiten in der Elfenbeinküste und in der Demokratischen Republik Kongo.
Viele Projekte. Der Bürgermeister treibt beim Ortsrundgang an, er hat noch so vieles zu zeigen: den Kindergarten, die Markthallen, das kommunale Radio, Gemüsegärten mit Brunnen für die Frauen, gemauerte Klassenräume und und und. Während einige Bauten ausschließlich von den MigrantInnen bezahlt wurden, überwiesen sie in anderen Fällen den Eigenbeitrag, den die Kommune leisten musste, um Geld von einer internationalen Hilfsorganisation oder bisweilen auch staatliche Fördermittel zu erhalten.

Seit gut zehn Jahren spielt auch ihre französische Partnerstadt Villetaneuse eine wichtige Rolle. Jedes Jahr realisiert sie gemeinsam mit der Bevölkerung von Koniakary ein Projekt.
Obwohl es langsam dunkel wird, will Bassirou Bane eine Sache noch unbedingt zeigen. Er führt zum Herz der Wasserversorgung von Koniakary. Die Pumpstation ist gerade eine Baustelle. „Wir mussten die Kapazität drastisch erhöhen“, erklärt der Bürgermeister, denn Koniakary ist gewachsen. Außerdem stellt die Gemeinde die Energieversorgung vom Generatorbetrieb auf ein Hybrid-System um. In diesem Fall waren die Solarpanele keine Spende „ihrer“ MigrantInnen, sondern wurden zum Teil mit einem Kredit bezahlt. Immerhin geht es bei dem Gesamtprojekt um umgerechnet rund zwanzigtausend Euro. Knapp die Hälfte davon spendierte ein interkommunaler Zusammenschluss in Frankreich namens „Pleine Commune“, den Rest strecken MigrantInnen in Frankreich den Ortsansässigen vor.
Dazu kommt noch das Geld, das die MigrantInnen aus allen Ländern individuell an ihre Familien schicken – für Grundnahrungsmittel, Schulgebühren, die medizinische Versorgung und alles, was sonst noch so anfällt. „Ich kann mir nicht vorstellen, wo wir ohne diese Überweisungen stünden“, sagt Bürgermeister Bane. Er selbst allerdings kommt ohne Unterstützung aus dem Ausland bestens aus: Schon sein Vater hat Koniakary nie verlassen und vor Ort als Händler ein Vermögen verdient. Sein Geld und sein Talent hat er Bane vererbt, wohl auch zum Nutzen der Gemeinde: Dass ihr Bürgermeister zupackend und vorausschauend ist und dabei mit Geld offensichtlich gut umgehen kann, trägt zum relativen Wohlstand des Ortes sicherlich bei.
Bettina Rühl ist freiberufliche Journalistin für Printmedien und Radio. Sie lebt in Nairobi, Kenia.