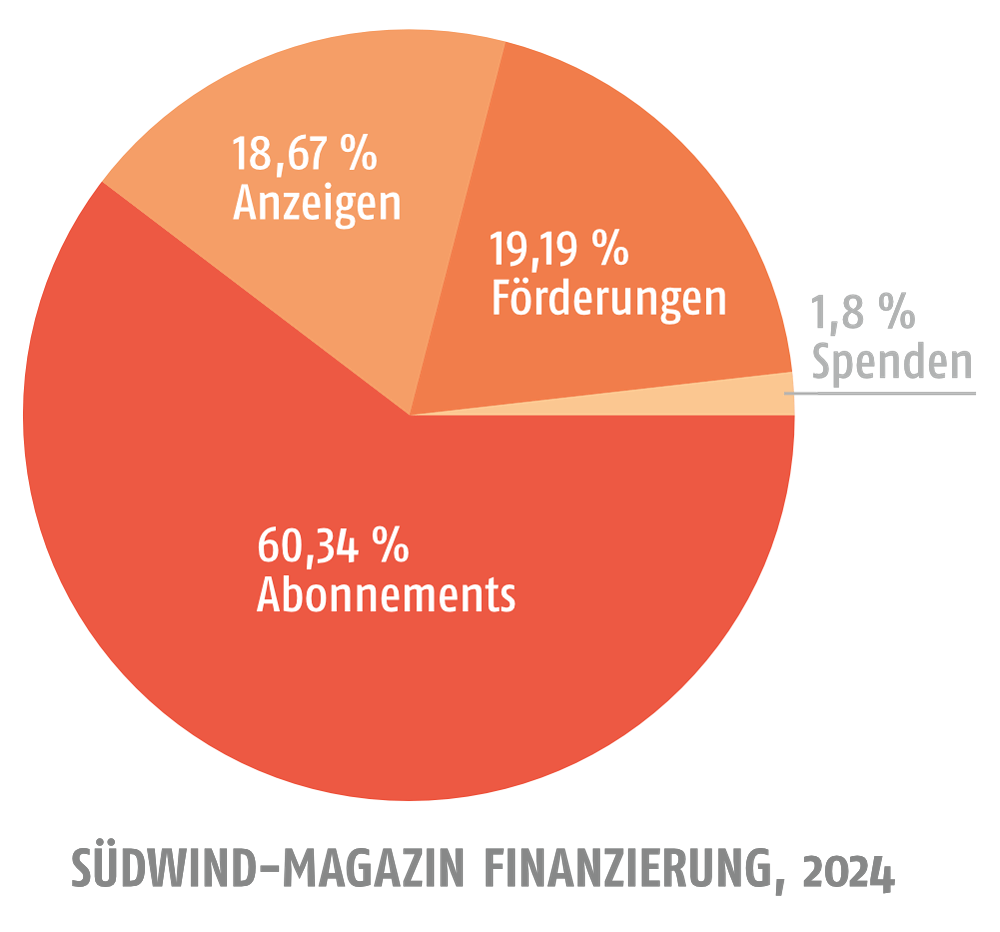Der kleine Ort Mpondwe, am Fuß der sagenumwobenen Rwenzori-Berge im Westen Ugandas gelegen, sprüht vor Leben. Chinesische Lastwagen, mit fünf Meter hohen Stapeln von Matratzen und Decken beladen, bahnen sich einen Weg durch die Menge lärmender Kinder und eifriger Marktfrauen. Schwitzende Arbeiter ordnen riesige Bretter aus feinstem Tropenholz in große Stapel. In den bunt dekorierten Ladenzeilen gibt es Konsumgüter aller Art, von Bananen bis zu Elektrogeräten. Dies ist das typische Uganda von heute – Transitland für Asiens Exportwaren nach Ost- und Zentralafrika, dank seiner hervorragenden Teerstraßen und seines verlässlichen Finanzsystems eine bevorzugte Drehscheibe vor allem für die weniger stabilen Nachbarregionen Kongos und Sudans.
An der Metallbrücke hinter dem unscheinbaren Polizeiposten endet die breite Teerstraße und geht in ein undefinierbares matschiges Gelände über. Auch die in Mpondwe geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer wird explizit per Verkehrsschild aufgehoben. Hier endet Uganda. Es beginnt die Demokratische Republik Kongo, ein Land ohne Straßen und Verkehrsregeln. Die großen Lastwagen, die auf ugandischer Seite noch so solide aussahen, balancieren nun wackelig über einen abschüssigen Weg aus zwei Spuren unterschiedlicher Höhe, die Fortsetzung der Hauptstraße. Hier im Staub liegt Kasindi, einer der wichtigsten Umschlagplätze für Ostkongos Im- und Export.
Zu früheren Kriegszeiten bot Kasindi den Zutritt zu einem unabhängigen Reich: dem Nordteil der ostkongolesischen Provinz Nord-Kivu, Domäne der umtriebigen HändlerInnen des kongolesischen Nande-Volkes. Ihr größter Standort Butembo, eine wuchernde Stadt von 500.000 Menschen mit einer fest im Sattel sitzenden Elite aus katholischer Kirche und selbstbewusster Zivilgesellschaft, aber ohne einen einzigen Meter geteerte Straße, galt als zentraler Knotenpunkt für Waren aus Dubai und für Exporte von kongolesischem Gold. Ein besonderes Zollregime galt hier: keine prozentualen Einfuhrzölle je nach Warenwert wie eigentlich im kongolesischen Gesetz vorgesehen, sondern eine Pauschale pro Lastwagen. Das machte Importe billiger und sicherte den Nande-HändlerInnen einen Wettbewerbsvorteil im gesamten Ostkongo. Nirgendwo sonst in der unruhigen Region gab es eine so solide implantierte Kaste von GroßhändlerInnen. Auch nachdem Kongos Krieg 2003 offiziell zu Ende ging, bewahrte sich dieser Ministaat auf wundersame Weise seine Privilegien, denn die Nande-Politiker sicherten sich großen Einfluss im Friedensprozess und auch in der gewählten kongolesischen Regierung ab 2007.
Erst seit diesem Jahr hat das ein Ende. Das alte Zollregime wird seit einigen Monaten nicht mehr angewandt. Jetzt gelten auch in Kasindi die kongolesischen Gesetze. „Die kleinen Händler mit Importwaren deklarieren ihre Güter drüben“, beschwert sich in Kasindi der Chef der Zollbehörde, „und wenn sie rüberkommen und wir ihnen sagen, dass sie sie hier auch deklarieren müssen, schimpfen sie über Willkür“. Auf der ugandischen Seite wettert sein Amtskollege in der „Uganda Revenue Authority“: „Die meisten Güter, die aus dem Kongo hierherkommen, haben überhaupt keine Papiere. Wir wissen nicht einmal, ob sie aus dem Kongo stammen.“ Vieles sei Schmuggelware aus anderen Ländern Afrikas. In Uganda gibt es Computer und eine einzige Behörde, an der die Händler vorbei müssen und ihre Zahlungen direkt und nachprüfbar tätigen – im Kongo gibt es deren zehn, mit unklaren Kompetenzen und teils überhaupt keiner legalen Daseinsberechtigung. Und alle arbeiten mit altertümlichen und fehleranfälligen handschriftlichen Bucheintragungen. In Kasindi-Mpondwe, diesem Großumschlagplatz für den ostafrikanischen Handel, wenden sich Uganda und Kongo praktisch den Rücken zu. Die beiden Länder gehören zu verschiedenen Zeitzonen. Wenn die Grenze in Kasindi nach kongolesischem Usus um 18 Uhr schließt, ist es in Mpondwe 19 Uhr. Die HändlerInnen und Beamten beider Seiten kennen einander nicht, und wenn sie sich kennen, trauen sie einander nicht.
Auf einem historischen Gipfeltreffen in Ugandas Hauptstadt Kampala Ende Oktober vereinbarten die drei großen Wirtschaftsblöcke des östlichen, zentralen und südlichen Afrika – SADC (Southern Africa Development Community), COMESA (Common Market of Eastern and Southern Africa) und EAC (East African Community) – die perspektivische Verschmelzung zu einer gigantischen Freihandelszone, die von Südafrika bis Ägypten reichen würde und über 500 Millionen EinwohnerInnen hätte. Aber wenn schon Ugander und Kongolesen, direkte Nachbarn, miteinander nicht zusammenarbeiten können, sind diese Perspektiven wohl ein frommer Wunsch. Auf einem Seminar von COMESA mit Unterstützung der britischen Entwicklungsagentur DFID im westugandischen Kasese versuchten Geschäftsleute und Behörden beider Länder parallel zum Gipfel von Kampala, ihre unterschiedlichen Sichtweisen miteinander zu konfrontieren. Mit desaströsen Ergebnissen: Mitten im verblüfften Plenum resümiert ein Ugander, dem man die reichhaltige leidvolle Erfahrung in Kongos Krisendistrikt Ituri ins Gesicht geschrieben sieht: „Unser Problem mit den Kongolesen ist: Es sind alles Diebe und Betrüger.“
Uganda verlangt für jede Einreise, die über den kleinen Grenzverkehr hinausgeht, ein Visum für 50 US-Dollar, klagen die Händler aus Kongo; und Transitwaren aus Asien für Kongo werden im Flughafen von Kampala auseinander genommen, auch wenn die Papiere zeigen, dass sie gar nicht nach Uganda eingeführt werden sollen. Die Retourkutsche aus Uganda: In Kongo weiß man gar nicht, mit wem man es zu tun hat und welche Regeln zählen. Die Visa gelten nicht einmal für das ganze Land, sondern nur für bestimmte Orte, und kongolesische KleinhändlerInnen kommen nach Uganda und machen dort völlig illegal ihre Geschäfte.
Uganda und Kongo teilen nicht nur das Rwenzori-Bergmassiv mit seinen Gletschern auf über 5.000 Meter hohen Gipfeln und ganz eigenen Ökosystemen und Kulturen. Sie teilen auch zwei Seen, den Albertsee, unter dem es riesige Ölvorkommen gibt, und den Eduardsee, der sehr fischreich ist. Um das Öl gerieten die beiden Länder im Sommer 2007 an den Rand eines Krieges. Die Fische schwimmen, wie sie wollen, und ihre Nationalität bemisst sich an der des Fischers. Aber wenn eine kongolesische Fischfrau in Uganda an einem illegalen Landeplatz ugandischen Fischern Fische abkauft, die kleiner sind als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgröße und sie über die Grenze trägt, welchem Land gehört dann die illegale Ware?
Auf den ersten Blick weniger problematisch, tatsächlich aber noch schwieriger ist der Handel mit Tropenholz. Uganda und andere ostafrikanische Länder wie Kenia erleben dank rapiden Städtewachstums einen gigantischen Bauboom, der Unmengen Holz verschlingt, und sie haben selbst wenig Wald. Über die Hälfte des in Uganda und Kenia genutzten Holzes stammt aus den Primärwäldern des Ostkongo. Doch gibt es in dieser Region nur eine einzige legale Holzeinschlagskonzession, im Besitz des thailändischen Unternehmens „Dara Forest“, und ansonsten nur Unmengen illegalen Ein- und Kahlschlags. HändlerInnen in Uganda liefern sogar Stihl-Motorsägen, deren Gebrauch in Uganda selbst verboten ist, auf Kredit an kongolesische Waldbewohner. Die fällen damit ihre Bäume und zahlen so ihren Kredit ab. Nicht einmal die einfachste Verarbeitung findet auf kongolesischem Gebiet statt. Die Bretter, die in Mpondwe unter freiem Himmel gestapelt sind, dürften sämtlich illegal sein.
Die Behörden im kongolesischen Kasindi konnten mit all dem bisher wunderbar leben, hatten sie doch ihr eigenes kleines Grenzreich mit speziellen Zöllen und Steuern, was gute Beziehungen zum Nachbarland garantierte. Jetzt ist das vorbei, dank der Durchsetzung der kongolesischen Gesetze im Zollbereich. Und in wenigen Jahren könnte der komplette Freihandel Realität werden. Aber niemand achtet auf Gesetze, was die Waren selbst angeht.
Denn in Kongo ist das mit den Gesetzen so eine Sache. In Vorbereitung auf den Freihandel organisiert COMESA an Ostkongos Grenzen ein sogenanntes „Simplified Trading Regime“, das Waren im Wert von unter 500 Dollar von allen Zöllen befreit. An den Grenzen zu Sambia, Burundi, Ruanda und nun Uganda ist dies bereits mit den Behörden durchgespielt und besprochen worden, jedes Mal zur Zufriedenheit aller Seiten. Realität ist es noch nirgends. Denn die entsprechenden Regelwerke muss erst die Regierung im fernen Kinshasa in Kraft setzen. Und das macht sie nicht.