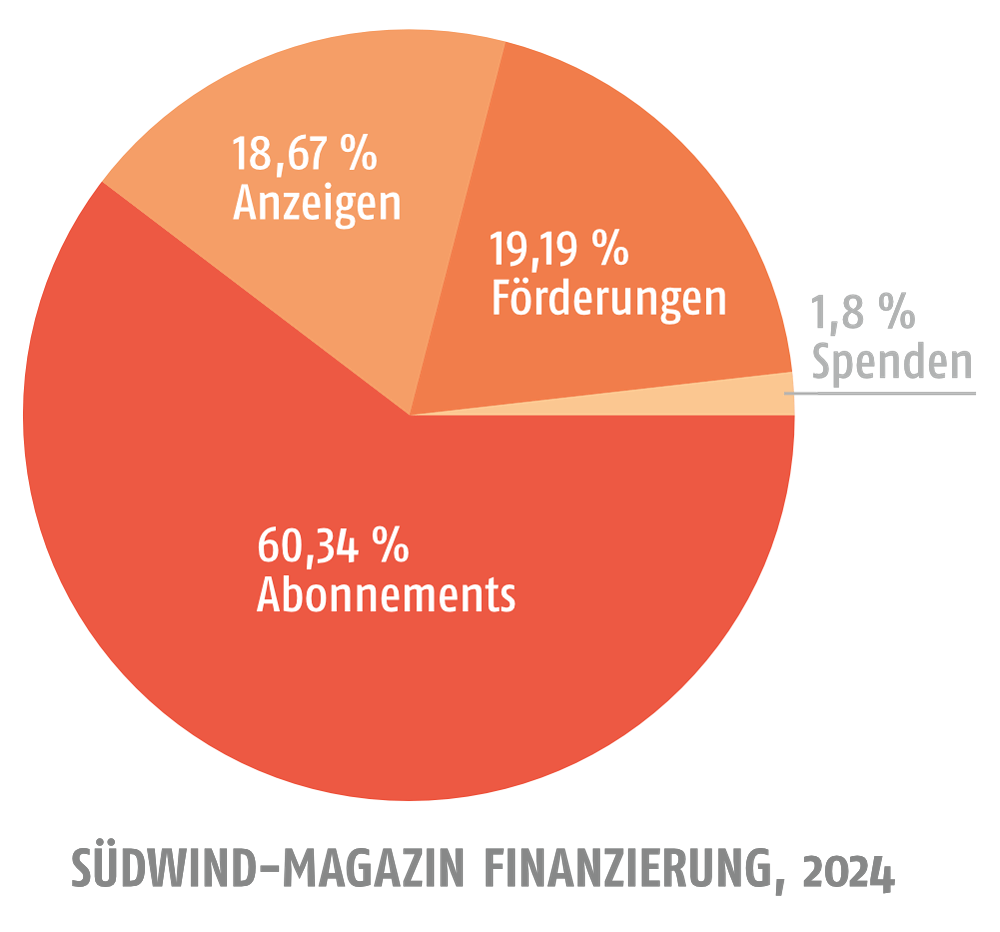Mit 36.000 Tonnen Mais an Bord erreichte das Schiff „Liberty Star“ Anfang August die Küste des von einer Hungerkatastrophe bedrohten südlichen Afrika. Doch die Regierungen von Simbabwe und Mosambik weigerten sich zunächst, die von der US-Regierung gespendete Nahrungsmittelhilfe ins Land zu lassen. Die USA können nämlich nicht garantieren, dass solche Lieferungen frei von gentechnisch manipuliertem (GM) Getreide sind. Die nach langen Verhandlungen gefundene Lösung lautet: Die Ware muss entweder im gemahlenen Zustand ins Land kommen oder sofort in Grenznähe zu Mehl weiterverarbeitet werden, um auszuschließen, dass die Maiskörner nicht gegessen, sondern als Saatgut ausgesät werden.
Keine solche Einigung gab es mit der Regierung von Sambia, die US-Nahrungsmittelhilfe in der Höhe von 50 Mio. US-Dollar ablehnte. Sie war an die Bedingung geknüpft, den Betrag für den kommerziellen Ankauf von Mais auf dem US-Markt auszugeben.
US-Regierung und Öffentlichkeit reagierten mit Empörung und Unverständnis. Ist es nicht absurd, das Verhungern von Menschen in Kauf zu nehmen, nur um das Land vor möglichen Risiken der Gentechnologie zu bewahren? Da 52 Prozent der weltweiten Nahrungsmittelhilfe aus den USA kommen, ist es auch nicht vorstellbar, auf diese wichtigste Gebernation zu verzichten.
Freilich haben auch die USA dazu beigetragen, dass es überhaupt zu diesem Konflikt kommen konnte: Über Jahre hinweg haben sie ihre Bauernschaft darin bestärkt, gentechnisch verändertes und traditionell produziertes Getreide zu vermischen, sodass sie gar nicht mehr in der Lage sind, Mais ohne transgenen Anteil zu liefern. Sie sind der weltweit bedeutendste Produzent von GM-Nutzpflanzen.
Von den weltweit 52,6 Mio. Hektar, die im Jahr 2001 mit GM-Saatgut bepflanzt wurden, entfallen 68% auf die USA, gefolgt von Argentinien mit 22% und Kanada mit 6%.
Saatgut, das mit den Methoden des US-Biotechnologiekonzerns Monsanto verändert worden war, wuchs auf 91% der Gesamtfläche. Mais war mit 19% der Gesamtfläche hinter Sojabohnen (63%) und vor Baumwolle (13%) das zweitwichtigste Produkt. Dabei lag der Anteil des manipulierten Saatguts für Mais in den USA bei 26%, für Baumwolle bei 68% und für Soja bei 80%. Angesichts der Vermischung von traditionellem und GM-Mais sowie der unterlassenen Deklarierung des Getreides konnte der Vorwurf nicht ausbleiben, die USA missbrauchten die Hungerkrise, um Afrika durch die Hintertür ihren manipulierten Mais aufzuzwingen und sich auf diese Weise neue Märkte zu erschließen.
Ist ausgerechnet die Nothilfe für Hungernde der geeignete Anlass, die eigene Sichtweise von der Unbedenklichkeit transgener Nahrungsmittel durchzusetzen?
Alice Wynne Willson von der britischen Hilfsorganisation Action Aid wendet sich einerseits dagegen, Genmais abzulehnen, wenn das auf Kosten von Menschenleben geschieht, meint andererseits aber: „Eine Hungerkrise sollte nicht als Hebel zur Einführung der Gentechnologie genutzt werden. Nur weil sie hungrig sind, verlieren die Menschen ihr Recht, Nein zu sagen.“ Dieses Recht, nein zu sagen, souverän über die für ihn akzeptablen Risiken und deren rechtliche Umsetzung zu bestimmen, wird jedem Staat durch das Cartagena-Protokoll zur biologischen Sicherheit garantiert. Ein Schönheitsfehler dabei ist, dass es völkerrechtlich noch nicht verbindlich ist – und dass die USA ihm nicht angehören.
Die USA müssen sich auch die Frage gefallen lassen, wie uneigennützig ihre Hilfe ist, wenn sie die Schenkungen oder Kredite in der Regel an die Bedingung des Einkaufs von US-Getreide knüpfen. Steht etwa das Ziel, die eigenen Überschüsse kostengünstig abzubauen, dabei im Vordergrund? Wäre es nicht grundsätzlich vernünftiger, nur das Geld bereitzustellen und die Empfängerländer selbst darüber entscheiden zu lassen, wo sie welche Nahrungsmittel einkaufen? Das wäre auch in der jetzigen Krise durchaus möglich: Tansania und Kenia haben angesichts einer besonders guten Maisernte im Vorjahr Sambia angeboten, den benötigten Mais von ihnen zu beziehen. Die Region ist also nicht unbedingt auf die Lieferung durch die USA angewiesen.
Bereits im Jahr 1996 hat die Europäische Kommission eine grundsätzliche Neuorientierung der europäischen Nahrungsmittelhilfe beschlossen. Seither hat nach dieser Richtlinie die Vergabe von finanziellen Mitteln gegenüber der Lieferung von Nahrung aus den Überschussbeständen Vorrang. Die EU unterstützt bei den derzeitigen Agrarverhandlungen innerhalb der Welthandelsorganisation auch die Forderung, Nahrungshilfe künftig grundsätzlich nur mehr als Schenkung zu vergeben, frei von jeder Lieferbindung, und dem Einkauf in der Region den Vorzug zu geben, falls das zu einem vertretbaren Preis möglich ist. Den Empfängerländern stünde es nach einer solchen Reform frei, nicht gentechnisch manipulierte Produkte zu kaufen.
Ein Nachteil, an dem auch eine derartige Regelung nichts ändern würde, sind die konkurrenzlos niedrigen Dumpingpreise, zu denen das in den USA produzierte Getreide infolge der astronomischen US-Agrarsubventionen angeboten wird. Während der in den Vereinigten Staaten produzierte Mais zu 190 US-Dollar pro Tonne inklusive Transport angeboten wird – 30 bis 40% unter den Gestehungskosten der US-Bauern –, kostet jener aus dem südlichen Afrika ohne Transport 260 US-Dollar. Internationale Kreditorganisationen wie IWF und Weltbank leisten dieser Marktverzerrung Vorschub, indem sie Druck auf die Länder ausüben, dort einzukaufen, wo die Preise am niedrigsten sind.
Auf der anderen Seite sind sie mitverantwortlich dafür, dass Länder wie Malawi, Simbabwe und Sambia der jetzigen Dürrekatastrophe noch schutzloser ausgeliefert sind, als sie das aufgrund von Korruption und eigener Fehler ohnehin gewesen wären: Sie wurden gezwungen, jene Gremien aufzulösen, die für Verteilung und Verkauf von Getreide zuständig waren, mit dem Argument, sie seien „subventioniert“ und störten das Funktionieren des freien Marktes. „Es ist eine Katastrophe“, meint dazu der Agrarökonom Laurence Cockcroft: „Wir können doch die Ernährungssicherheit nicht auf dem Altar der Ökonomie des freien Marktes opfern!“
Dafür, dass Sambia den US-Mais überhaupt nicht – bzw. Mosambik und Simbabwe nur in gemahlenem Zustand – ins Land lassen, gibt es ernst zu nehmende Argumente. Ausschlaggebend ist die Befürchtung, es könne zur Aussaat der Körner kommen. In der Folge könnten die eingebauten Fremdgene auf andere Nutz- oder Wildpflanzen übertragen werden, mit unkalkulierbaren Folgen für die biologische Vielfalt, die gerade für die traditionelle Landwirtschaft der Kleinbauernschaft von großer Bedeutung ist. Würde etwa das berüchtigte „Terminator-Gen“, das für die Sterilität der geernteten Körner sorgt, auf traditionelle Maissorten auskreuzen, wäre das für den Mais, eines der Hauptnahrungsmittel im südlichen Afrika, eine Katastrophe. Eine andere Befürchtung ist, dass durch das Überspringen von Resistenzgenen gegen Herbizide auf wilde Pflanzen ein „Superunkraut“ entstehen könnte, das nur schwer zu bekämpfen wäre. Berechtigt ist auch die Sorge, die zukünftigen Chancen der Region, ihr bisher als garantiert gentechnikfrei geltendes Getreide und andere Nahrungsmittel nach Europa exportieren zu können, würden aufs Spiel gesetzt.
Dass solche Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen sind, machte im vergangenen Frühjahr die Kontroverse um eine in den mexikanischen Provinzen Oaxaca und Puebla entdeckte Übertragung solcher „Transgene“ auf traditionelle Maissorten deutlich. Obwohl zahlreiche WissenschaftlerInnen aufgeboten wurden, um die Bedeutung dieses Befundes zu verharmlosen, kam Jorge Soberón von Mexikos Biodiversitätskommission zum Schluss, es handle sich um den „bisher weltweit schlimmsten Fall von gentechnischer Kontaminierung“. Diese Genübertragung hat stattgefunden, obwohl die mexikanische Regierung 1998 das Anpflanzen von Genmais verboten hat. Allerdings importiert Mexiko, Ursprungsland und bis vor kurzem Exporteur von Mais, inzwischen ein Viertel seines Bedarfes aus den USA; Abertausende kleine Maisbauern verloren ihre Existenz.
Eine wesentliche Frage, die durch die jüngste Kontroverse aufgeworfen wurde, ist die nach der Tauglichkeit transgener Pflanzen im Kampf gegen Armut und Hunger, wie sie von den BefürworterInnen dieser Technologie behauptet wird. Doch die Ursache für die Verarmung und oft niedrige Produktivität der afrikanischen Kleinbauern und -bäuerinnen, die den Löwenanteil der Nahrungsmittel produzieren, ist nicht das Fehlen geeigneter Technologien. Es ist ihre Verdrängung auf für nachhaltige Landwirtschaft ungeeignete Flächen, es sind für sie nachteilige Strukturen und makrökonomische Politiken. „Da die Preise niedrig sind und es nur wenige KäuferInnen gibt, produzieren sie weit weniger, als sie mit dem vorhandenen Know-how und den existierenden Technologien könnten“, erklärt Peter Rossett von „Food First/Institute for Food and Development Policy“ (Oakland, Kalifornien). Kein neues Saatgut könne an diesen Faktoren etwas ändern. Er warnt außerdem davor, dass die transgenen Pflanzen, die – meist mit Hilfe des von „Monsanto“ eingebauten „Bt“-Gens – ihr eigenes Insektizid produzieren, angesichts der raschen Herausbildung von Resistenzen seitens der Schädlinge in kurzer Zeit versagen werden. Bt-Pflanzen gefährdeten darüber hinaus nützliche Organismen sowie ökologische Prozesse – und reduzierten die Bodenfruchtbarkeit.
Angesichts dieser Kontroverse droht in Vergessenheit zu geraten, dass es für Afrikas Bauernschaft aber durchaus Alternativen jenseits von Agrochemikalien und der Produkte jener Hand voll Betriebe gibt, die den globalen Markt für Gentechnologie in der Landwirtschaft kontrollieren – Pharmacia (Monsanto), DuPont, Syngenta, Bayer, Dow.
So ist es Äthiopien nach seiner Hungerkrise gelungen, solche Alternativen zu entwickeln. Tewolde Berham Gebre Egziabher erhielt den Alternativen Nobelpreis, weil er zeigte, dass die äthiopische Landwirtschaft ohne diese Technologien einen vielfältigen und nahrhaften Überschuss erzeugen kann.