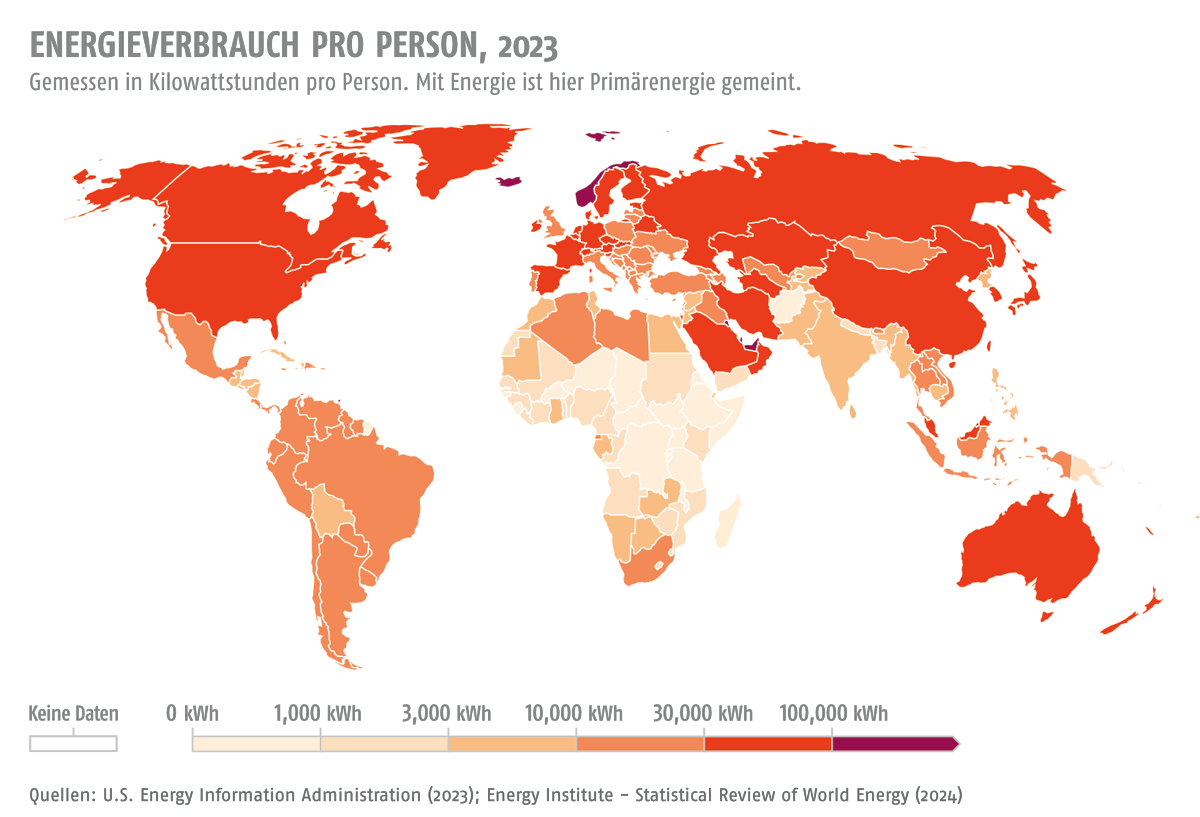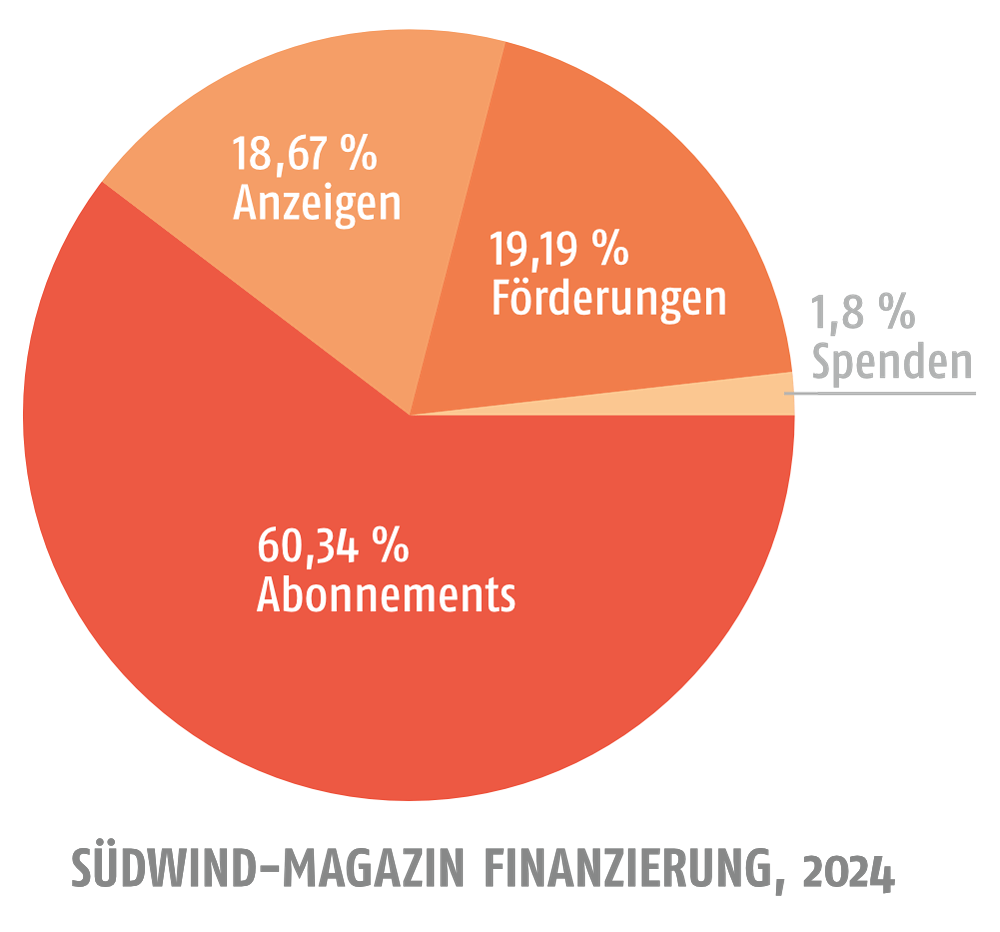
Die Genfer Flüchtlingskonvention weitergedacht

70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention: Vielen afrikanischen Ländern geht sie nicht weit genug.
Die Verteidigung der Menschenrechte ist Hamado Dipamas Leidenschaft. Dafür engagiert er sich jeden Tag, seit er vor 20 Jahren aus seiner Heimat Burkina Faso geflohen ist. Als junger Student stellte er sich dort mit vielen anderen gegen die Diktatur von Blaise Compaoré, der das Land bis zu seinem Sturz 2014 mit harter Hand regierte. Über Umwege landete Dipama in seiner neuen, „zweiten“ Heimat: der bayerischen Landeshauptstadt München.
„Als ich auf der Flucht war, ist mir die Genfer Flüchtlingskonvention nicht bewusst gewesen“, sagt Dipama. „Im Globalen Süden haben Menschen wenige Informationen darüber.“ Nach seiner Ankunft in Europa und der Ablehnung seiner Anerkennung als Flüchtling musste er sich damit auseinandersetzen und fragte sich: „Warum erhalten bestimmte Menschen Schutz und ich nicht?“
Anerkennung des Flüchtlingsstatus. Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist 70 Jahre alt. Sie wurde am 28. Juli 1951 verabschiedet. Sie ist eine unverzichtbare Grundlage des internationalen Flüchtlingsschutzes. Sie legt fest, wer ein Flüchtling ist. Anrecht auf diesen Status haben Menschen, die aus politischen, ethnischen oder religiösen Gründen verfolgt werden und ihr Land verlassen haben.
In der Folge des Zweiten Weltkriegs und angesichts wachsender politischer Spannungen zwischen Ost und West verabschiedeten die Vereinten Nationen die Konvention 1951 in Genf. Zunächst war sie aber darauf beschränkt, hauptsächlich europäische Flüchtlinge direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. Um der geänderten Lage weltweit gerecht zu werden, wurde der Wirkungsbereich der Konvention 1967 mit einem Protokoll erweitert. 149 Staaten haben eine oder beide Vereinbarungen unterzeichnet.
Pflicht der Staaten. Die Konvention spiele heute immer noch eine wichtige Rolle, sie sei das einzige Dokument, das Staaten verpflichte, Flüchtlingen Schutz zu gewähren, sagt Susan Fratzke, Analystin am Migration Policy Institute in Brüssel. Heute seien Menschen aus anderen Gründen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, als in der Situation des Kalten Krieges: Regierungen scheitern, rivalisierende Gruppen kämpfen um die Macht, die Wirtschaft in den Heimatländern bricht zusammen und sie können ihre Familien nicht ernähren. „Nichts davon ist in der Konvention einbezogen. Aber das heißt nicht, dass sie unbrauchbar geworden ist. Wir müssen weiterdenken und kreativer werden, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden“, so Fratzke.
Schon in den 1990er Jahren war sich das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) bewusst, dass eine neue Migrationsbewegung entsteht – von „Menschen, die nicht mehr vor Verfolgung fliehen, sondern in der Hoffnung auf ein besseres Leben“, sagte damals Douglas Stafford, damaliger Vize-Hochkommissar. Auch 30 Jahre später kann Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen flüchten, kein Flüchtlingsstatus nach der GFK zuerkannt werden.
Afrikanische Aufnahmeländer. Mittlerweile gehören einige afrikanische Länder zu den Staaten, die weltweit am meisten Flüchtlinge aufnehmen. Fast jedes Land des Kontinents hat die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Uganda, selbst eines der ärmsten Länder der Welt, gilt als Spitzenreiter in Sachen fortschrittlicher Flüchtlingspolitik. „Viele Staaten sind einen Schritt weiter gegangen“, sagt Analystin Fratzke. Und zwar durch die Annahme der Flüchtlingskonvention der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) – der Vorgängerorganisation der Afrikanischen Union. Damit geben sie Flüchtlingen „gesetzliche Rechte, die in der Genfer Flüchtlingskonvention nicht vorgesehen sind“.
Auch der Politologe Abiy Ashenafi, der die Migrationsstelle im Zentrum für Menschenrechte an der Universität Pretoria in Südafrika leitet, findet, durch das OAU-Abkommen seien einige der Unzulänglichkeiten der GFK beseitigt worden, etwa die zu eng gefasste Definition des Begriffs Flüchtling.
Afrikanische Erweiterung. Die Konvention der OAU ist 1969 auf einer Konferenz in Addis Abeba beschlossen worden. Sie lehnt sich an die Definition der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 an, erweitert aber aus den afrikanischen Erfahrungen mit Befreiungskriegen, Bürgerkriegen, Staatsstreichen, religiösen und ethnischen Konflikten sowie Naturkatastrophen die Definition, wer als Flüchtling gilt.
Sie lässt sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge außen vor, verzichtet aber auf das bei Massenfluchtbewegungen unpraktikable Erfordernis einer „begründeten Furcht vor Verfolgung“, wie sie im Text der Genfer Flüchtlingskonvention steht. Stattdessen fokussiert sie auf Fluchtursachen, die für massenhafte Vertreibungen am afrikanischen Kontinent mehr Bedeutung haben.
Doch es scheitert häufig – wie so oft – in der Umsetzung: Vielen afrikanischen Ländern, die Geflüchtete unterbringen, mangelt es an Ressourcen, sie sind selbst fragile Staaten mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Politischer Wille fehlt. Und auch die GFK bleibe hinter ihrem Potenzial zurück, sagt Politologe Ashenafi. Es fehle an internationaler Zusammenarbeit, weil es keine Verpflichtungen für eine gemeinsame Verantwortung gebe. Ashenafi: „Es muss eine Art verbindliche Norm in dieser Hinsicht geben. Dies kann durch eine Reform der UN-Flüchtlingskonvention erreicht werden.“
Eine Lücke in der Konvention ist dem Politikwissenschaftler zufolge, dass sie keinen Beschwerdemechanismus für Flüchtlinge gegen Aufnahmestaaten vorsehe. Festgeschrieben ist laut Expertin Fratzke in der GFK das Recht der Geflüchteten, nicht zurückgeschickt zu werden in ein Land, in dem sie verfolgt werden. Sie könnten sich im Aufnahmeland frei bewegen, zur Arbeit gehen und eine Schule besuchen.
Aber: „Jeder Staat, der unterzeichnet hat, muss seine Verpflichtungen aus der Konvention durch entsprechende Asyl-Gesetze innerstaatlich umsetzen.“ Das Problem dabei ist: „Viele Staaten sind dazu nicht gewillt oder in der Lage. Als Konsequenz ist es für Flüchtlinge schwer, Schutz zu erhalten, obwohl sie im Rahmen der Konvention ein Recht darauf haben.“
Theorie versus Praxis. Die Praxis weiche stark von der Konvention ab – auch in Europa, kritisiert auch Dipama in München. Abschiebepraktiken seien fragwürdig. Zum Beispiel, wenn in Deutschland bereits integrierte Menschen wieder in ihr instabiles Heimatland zurückgeschickt würden.
Dipama kennt die Angst vor Abschiebung. Er lebte neun Jahre als geduldeter Flüchtling, hat gegen die Abschiebung gekämpft. 2014 hat er eine Niederlassungserlaubnis bekommen. Vor einem Monat beantragte er seine Einbürgerung. „Das war für mich auch kein leichter Schritt, weil ich meinen burkinischen Pass abgeben muss.“ Seit 2007 ist er Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats und gründete den Arbeitskreis Panafrikanismus, der sich für die Belange Schwarzer Menschen einsetzt.
Was er sich für die Zukunft wünscht? „Die Staaten sollen das tun, was sie in der Konvention unterschrieben haben, und das Dokument novellieren, damit Geflüchtete mehr Schutz erhalten.“
Martina Schwikowski ist Korrespondentin der deutschen Tageszeitung taz für das südliche Afrika und lebt in Johannesburg.