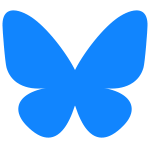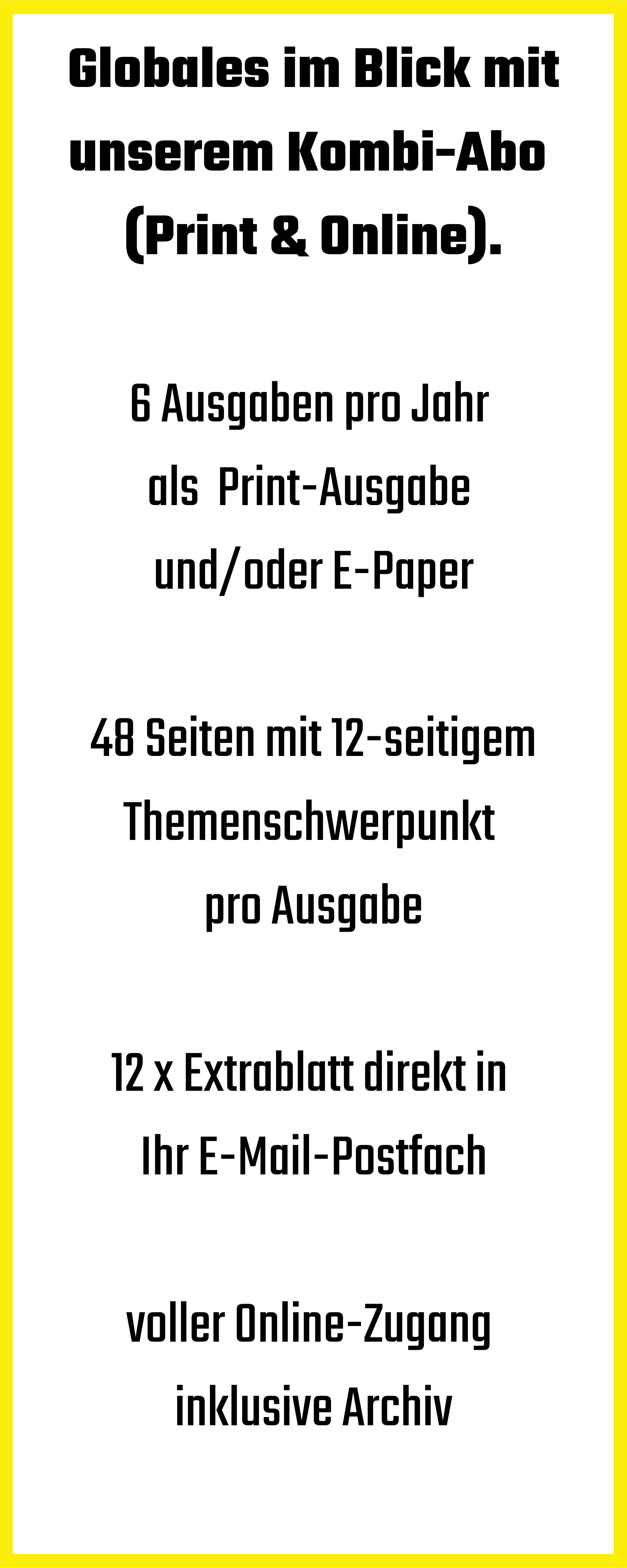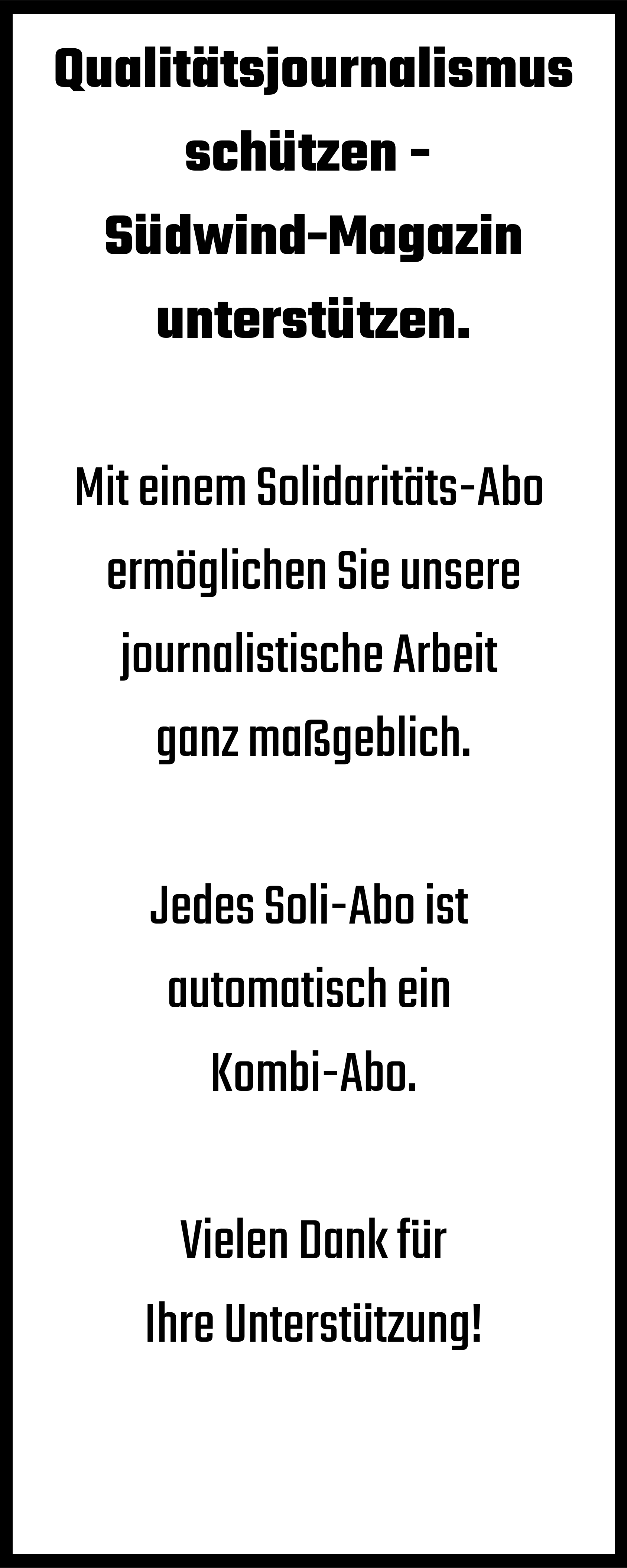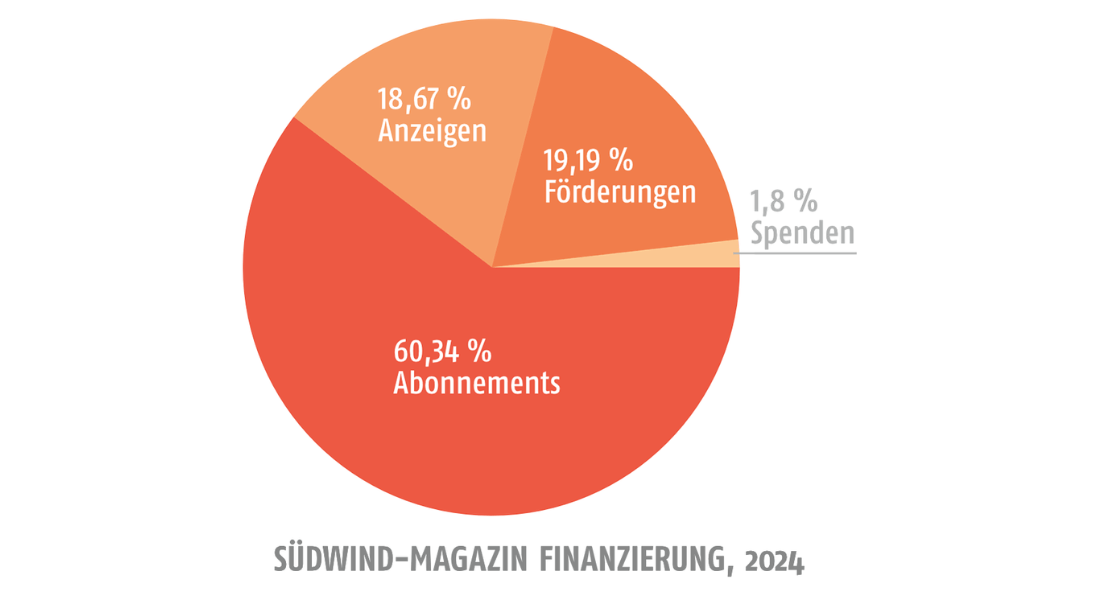Die Architektur der Bewegung

Die Eco-Social-Designerin Nina Sandino verbindet Kunst und Gemeinschaft, um uns die unsichtbaren Geschichten hinter unserer Kleidung näher zu bringen.
Nina Sandino war schon vieles in ihrem Leben: Architektin, Aktivistin, Tänzerin und Tanzpädagogin. Heute vereint sie all diese Fähigkeiten unter dem Titel Eco-Social-Designerin. Architektur hat die 38-Jährige in Managua, der Hauptstadt Nicaraguas studiert, Tanzpädagogik in Wien. „Ich wurde in der nördlichen Karibik in Nicaragua geboren, in Puerto Cabezas, auch genannt Bilwi in der indigenen Miskito-Sprache. Das bedeutet kleine Schlange auf einem Blatt. Aber aufgewachsen bin ich am Pazifik. Das ist ein großer Unterschied,“ erzählt sie. Die Liebe hat sie mit 24 Jahren dazu gebracht, den Kontinent zu wechseln. Auf ihrer Website steht ein Gedicht der nigerianischen Dichterin Ijeoma Umebinyuo:
So, here you are
too foreign for home
too foreign for here
never enough for both.
Man könnte es so übersetzen: „Hier bist du nun, zu fremd für zu Hause, zu fremd für hier. Nie genug für beide.“ Ein Gefühl, das viele Menschen kennen, die in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, als ihre Eltern. Oder die in ihrer Kindheit und Jugend häufig umgezogen sind. Diese Menschen nennt man Third Culture Kids. Dass dieses Gefühl auch innerhalb eines Landes entstehen kann, weiß Sandino aus eigener Erfahrung: „Mein zweiter Nachname ist Rossmann. Die Familie meines Papas ist weiß und kommt aus der Kolonialstadt Granada. Ein Urgroßvater stammte aus Deutschland und kam wegen des Goldfiebers nach Nicaragua. Die Familie meiner Mama hat indigene und Schwarze Wurzeln. Meine Großmutter konnte noch Miskito sprechen. Meine Mama hat es nicht mehr gelernt, weil indigene Sprachen verboten wurden. In der Schule durfte sie nur Spanisch sprechen.“
Kirche und Kolonialismus. Während die Pazifikküste in Nicaragua von Spanien kolonisiert wurde und die Mehrheit der Bewohner:innen heute Mestiz:innen sind, leben in der Karibik die Nachkommen versklavter Menschen und die indigene Bevölkerung. Die dichten Mangrovenwälder, Schlangen und Moskitos verhinderten das Durchkommen der Spanier. Während sich an der Pazifikküste die katholische Kirche durchsetzte, gab es in der Karibik unterschiedliche Einflüsse wie die Obeah Woman – weibliche spirituelle Heilerinnen oder Schamaninnen. Die Obeah-Tradition ist eine afro-karibische spirituelle Praxis, die Elemente afrikanischer Religionen und indigene Glaubenssysteme verbindet. „Für mich war schon in Nicaragua klar, dass, obwohl meine beiden Eltern aus Nicaragua kommen, ich immer schon zwischen zwei Welten war. Die Unterschiede zwischen den Familien waren so groß.“ Es war ihre Familiengeschichte, die Sandino 2019 auf das Thema Fast Fashion brachte.
Frage der Empathie. Ihre Großmutter mütterlicherseits war Schneiderin. Der Großvater war als Fischer viel unterwegs, und sie musste sich meist allein um die vier Kinder kümmern. Um ihr Einkommen aufzubessern, fuhr sie nach Managua, und kaufte große Pakete Secondhand Kleidung. „Wir durften uns etwas aussuchen und den Rest hat sie weiterverkauft. Die Geschichte meiner Oma hat mich sehr traurig gemacht. Das brachte mich zur Frage: Wieso kann ich empathisch mit meiner Oma sein, aber nicht mit anderen Frauen, die unsere Kleidung nähen?“ Noch im selben Jahr kaufte die Eco-Social-Designerin mit Künstlerkolleg:innen 100 Kilogramm unsortierte Textilien im Carla Secondhand Shop.
Bis heute macht sie Installationen aus diesem Material. Die Fußballtrikots, Stofftiere und Vorhänge helfen ihr, in Kontakt mit den Menschen zu kommen. „Das ist die Kleidung, die im Globalen Süden landet. Wir kriegen T-Shirts mit Logos, Sätzen auf Englisch oder anderen Sprachen und tragen das, ohne zu wissen, was es bedeutet.“
2021 entwarf Sandino gemeinsam mit der Designerin Alexandra Fruhstorfer eine Installation für die Vienna Design Week. Die Idee: Im urbanen Raum mit Passant:innen zu arbeiten. Dazu bauten sie ein Fahrrad zu einem mobilen Kleiderkasten um, dem Open Mobile Garment-Vehikel, kurz OMG, und luden auf der Mariahilfer Straße zur Kleidertauschparty ein. „So habe ich meinen Weg ins Eco-Social-Design gefunden, weil ich alles verbinden konnte: Architektur, Bewegung und Aktivismus“, erzählt die Künstlerin. Es ist ein Versuch verschiedene Themen, die politisch relevant, aber abstrakt sind, greifbar zu machen.
Neue Rituale. Mit Studierenden der Universität Bozen entwarf Sandino 2024 eine Aktion, die sie Plastic Supper tauften, in Anlehnung an das Last Supper – das letzte Abendmahl. Zusammen kochten sie essbaren Biokunststoff aus Agar-Agar und Heidelbeeren. Diese Masse gossen sie in T-Shirt-Silikonformen. Die kleinen T-Shirts sollten an die Hostie in der Kirche erinnern.
Sandino versucht sich von der frontalen Performance zu lösen und gemeinsame Erlebnisse ohne Hierarchie zu schaffen: „Immer mehr Menschen sind nicht gläubig, aber trotzdem brauchen wir Rituale, um uns auf Handlungen zu einigen. Was heute fehlt, ist Spiritualität.“ Sie verweist auf das okularzentrische Paradigma in der westlichen Welt, das auch in der Architektur vorherrscht. Das bedeutet, dass die anderen Sinne den Augen untergeordnet sind und das Sichtbare dominiert. „Das, was wir nicht sehen können, können viele nicht wahrnehmen. In globalen Lieferketten wird vieles unsichtbar. Am Etikett steht zwar Made in Bangladesh, aber wir sehen nicht, wo die Baumwolle herkommt. Oder wohin die Altkleidung verschwindet“, sagt Sandino. In ihren Installationen versucht sie Verbindungen herzustellen und Information zu liefern, etwa in Form von einem Fanzine-Heft oder einem QR-Code mit Links. Ihre Lösung für das Fast Fashion-Problem liegt in der Gemeinschaft. „Meine Arbeit ist nicht nur meine Arbeit, ich bin das Resultat von Anderen, damit meine ich nicht nur meine Familie und mein kulturelles Erbe, sondern auch die Menschen, die ich hier gefunden habe. Wie alle Lebewesen und Pflanzen brauchen wir die Gemeinschaft.“
Fair Fashion Termine:
Fashion Revolution Week
22. bis 27. April 2025Save the date – Re:pair Festival
13. bis 31. Oktober 2025
im Atelier Augarten in Wien