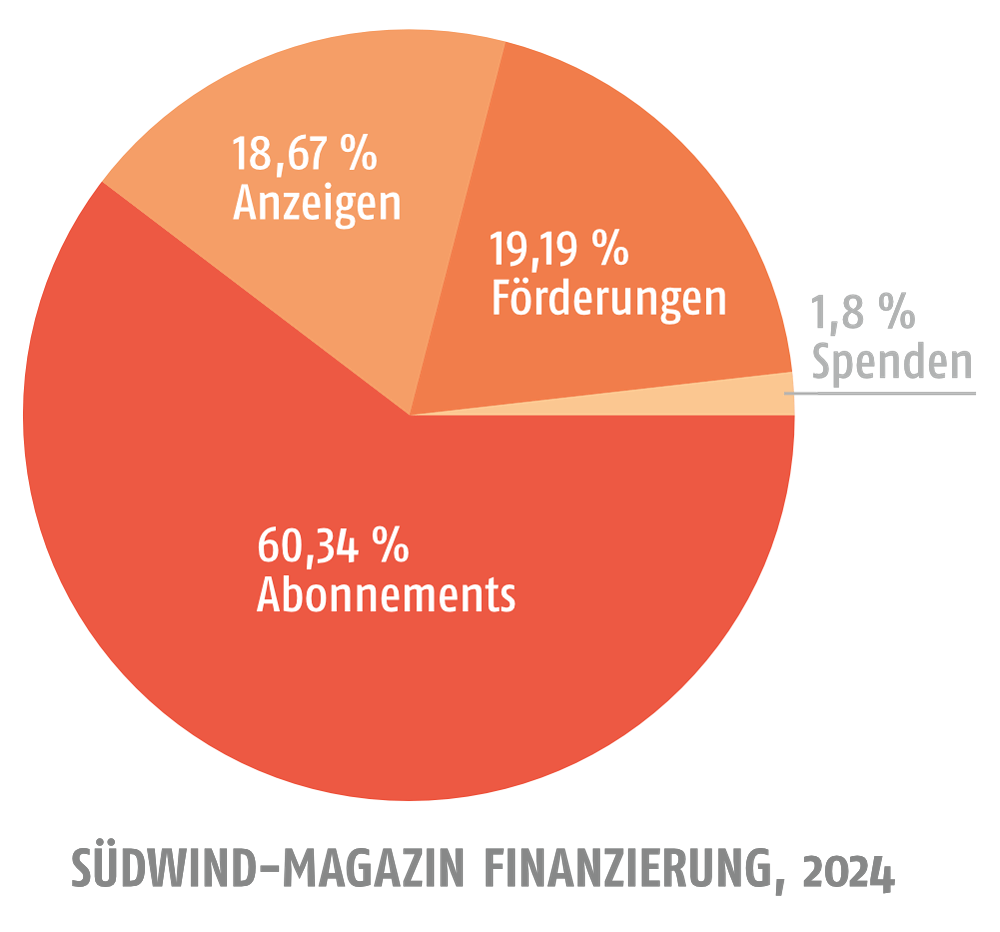Nur ein Viertel der Entwicklungsgelder werde tatsächlich zur Förderung von Entwicklung eingesetzt. So lautet eine der etwas zugespitzten Thesen von Peter Niggli in seinem Buch „Streit um die Entwicklungshilfe“. Dennoch ist der Schweizer Experte kein Fundamentalkritiker der Entwicklungszusammenarbeit.
Niggli bevorzugt den aus der Mode gekommenen Begriff Entwicklungshilfe: „Im deutschsprachigen Raum verstehen alle einfachen Leute, was damit gemeint ist.“ Der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Hilfswerke, Alliance Sud, räumt ein, dass seit dem Ende des Kalten Krieges „mehr Gelder aus den Entwicklungshilfebudgets tatsächlich für Entwicklungshilfe ausgegeben werden als für strategische Interessen, Schmieren befreundeter Regierungen, Absicherung eigener Interessen“.
In den letzten 45 Jahren sei jedoch „nur ein Teil dieses Topfs richtig eingesetzt“ worden. Niggli meint mit den „falschen“ Ausgaben all jene Beträge, die nach OECD-Regeln als EZA (Entwicklungszusammenarbeit) angerechnet werden dürfen, wie Verwaltungskosten der Agenturen, für AsylwerberInnen, Stipendien und Studienplätze für Studierende aus dem Süden. Er kritisiert aber auch die „gebundene Hilfe“, wenn man die Empfängerländer verpflichte, Waren aus dem Geberland zu kaufen oder dessen Firmen im Projekt zu beschäftigen. Nicht zuletzt will er auch fehlgeleitete Gelder herausrechnen: „Unter dem Titel strukturelle Anpassung wurde versucht, die Wirtschaft dieser Länder an unserer Sicht einer voll liberalisierten integrierten Weltwirtschaft auszurichten.“
Wo die Welthandelsorganisation die armen Länder von der sofortigen Öffnung ausgenommen habe, hätten die Industrieländer „über Entwicklungshilfe und Weltbank die gleiche Stoßrichtung durchgesetzt: Liberalisierung, Privatisierung, Schrumpfen des Staates in der Hoffnung, dass dann Marktkräfte frei werden“. Das Ergebnis dieser Politik sei fatal: Wie man sieht, habe jedes erfolgreiche Entwicklungsland keine Strukturanpassung hinter sich.
Niggli fürchtet, dass die gegenwärtige Finanzkrise teilweise auf die ärmsten Länder abgewälzt werde: „Mit sinkenden Steuererträgen schon in diesem Jahr ist zu rechnen. Im nächsten sicher. Da werden die Entwicklungshilfe-Budgets unter Druck kommen.“ Er setzt aber dennoch Hoffnungen in die UN-Konferenz, die im Dezember in Doha die Entwicklungsfinanzierung diskutieren soll: „Wir verpflichten uns da, verbindliche Zeitpläne zu machen. So steht das im Verhandlungstext.“ Der Schweizer Fachmann rechnet allerdings damit, dass man „wie üblich auf Betreiben der USA“ die 0,7 Prozent aus dem Text streichen werde. 0,7 Prozent des jeweiligen Bruttonationaleinkommens wollen die Industriestaaten bis 2015 für EZA bereitstellen.
Auch die Erklärung von Paris aus dem Jahr 2005, die die EZA partnerschaftlicher ausrichten will, beurteilt Niggli im Prinzip positiv: „Das war ein Versuch, einige Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Wir dürfen die EZA nicht so konzipieren, dass sie den lokalen Markt oder den Staat schwächt.“ Eine Konsequenz der Pariser Erklärung ist das Abgehen von der Projektfinanzierung und das Hin zu mehr direkter Budgethilfe. Niggli sieht das als Resultat eines Pendelausschlags: „Anfang der 1990er Jahre wurde der Staat als Hindernis für die Entwicklung betrachtet. Er wurde als korrupt beurteilt und es ging darum, seinen Einfluss zurückzudrängen. Jetzt schlägt das Pendel zurück, man sieht gescheiterte Staaten als Problem auch für die Nachbarn und die Stabilität der Region. Man sagt sich, wenn man den fragilen Staat aus der Fragilität herausführen will, muss man Gelder über den Staat und seine Institutionen kanalisieren.“ Leider sei das Pendel zu weit ausgeschlagen. Denn die anderen Entwicklungsakteure kämen zu kurz. Man müsse dafür Sorge tragen, dass eine Vielfalt an AkteurInnen beteiligt werde: „Wenn man alle Gelder auf Budgethilfe konzentriert, schwächt man den Multistakeholder-Ansatz.“
Insgesamt vermisst Niggli die entwicklungspolitische Kohärenz. Dass die EU die afrikanischen Staaten dränge, ihre Importzölle abzubauen, sei Unsinn. Denn mangels nennenswerter Steuereinnahmen hänge das Funktionieren vieler Staaten von den Zöllen ab. „Die Entwicklungshilfe ist eben ein Exot im außenpolitischen Instrumentarium der entwickelten Länder. Daneben pushen die Industriestaaten ihre Eigeninteressen. Ich kenne kein Handelsministerium, das ernsthaft dazu Überlegungen anstellt. Wir verfolgen eine widersprüchliche Politik, das wissen wir schon lange. Der einzige Fortschritt ist, dass man darüber streitet.“ Niggli sieht allerdings noch keine Veränderungen: „Die Schweiz zum Beispiel ist dort bereit, kohärenter zu agieren, wo sie keine eigenen Interessen hat.“
Das Gespräch mit Peter Niggli führte Südwind-Mitarbeiter Ralf Leonhard. Der Schweizer Experte nahm Anfang Oktober auf Einladung des Wiener Instituts für internationalen Dialog und Zusammenarbeit (VIDC) in Wien an einer Veranstaltung teil.