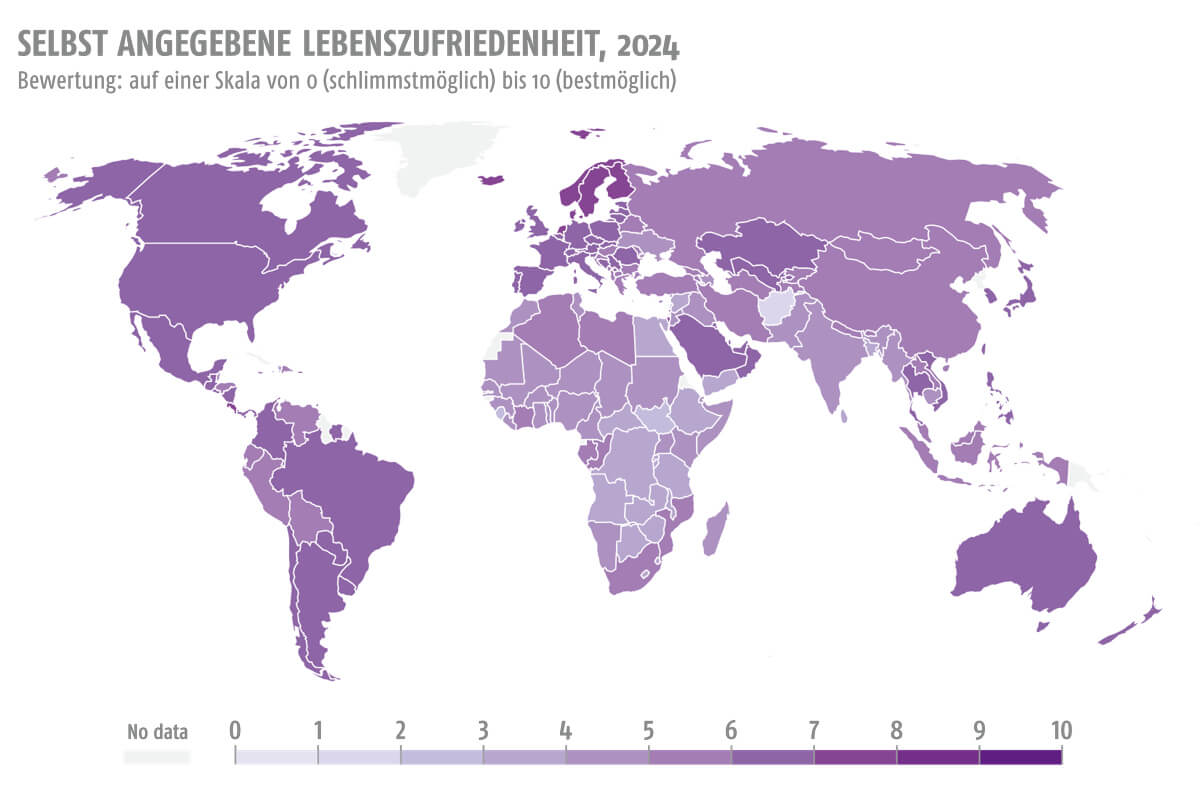Als sein Hochzeitstag näher rückte, erinnerte sich Samuel Kabue an eine längst vergangene Gefälligkeit. Als Kind war er von einem Radfahrer niedergefahren worden, als er in seiner Heimatstadt Nairobi unterwegs war, und da hatte sich ein Mann eingemischt. Zuerst hatte er den Radfahrer festgehalten, der sich davonmachen wollte, und sich dann die Zeit genommen, Samuel zu seiner Mutter zu bringen. Später besuchte Samuel immer wieder den Buchladen dieses Mannes, zuerst alleine, dann, nachdem er erblindete, in Begleitung.
Nun stand Samuel vor ihm, eine Einladung in der Hand. „Mit der ganzen inneren Erregung, die wohl jeder in meiner Situation empfunden hätte, überreichte ich ihm die Einladung. Seine Reaktion machte mich tief betroffen. Er schwieg eine Zeit lang und sagte dann zu mir: ‚Warum willst du dir das Leben noch schwerer machen? Du bist ja schon blind, wie willst du mit der Last der Ehe zurechtkommen?‘“1
In Mumbai begann eine engagierte behinderte Frau unter einem Pseudonym über Sex zu schreiben – einen Teil ihres Lebens, dessen Existenz von anderen stets verleugnet wurde. Als sie einmal den Mut gefunden hatte, das Thema aufs Tapet zu bringen, zeigten ihr selbst Behinderte, die wie sie um ihre Rechte kämpften, die kalte Schulter: Sie wurde wegen ihrer „westlichen Obsession“ verhöhnt – Menschen mit Behinderungen in Indien hätten doch viel wichtigere Dinge, für die sie kämpfen müssten.
Firdaus Kanga, auch ein Kind dieser indischen Metropole, versöhnte sich mit dem, was ihn seiner Ansicht nach von den anderen unterschied. Er hatte von Geburt an sehr spröde Knochen, und schon als Bub fiel es ihm schwer, ein Keks auseinanderzubrechen. „Etwas an dem Klang, an dem Knacken, erinnerte mich stets daran, wie ich mir eine Rippe oder einen Hüftknochen gebrochen hatte, was beinahe genau so häufig war wie Feiertage im indischen Kalender.“ Der „Unterschied“, mit dem er sich befasste, war seine Homosexualität – ein Thema, das in der gehobenen indischen Gesellschaft so tabu war, dass er nie jemand darüber reden gehört hatte. „Homosexualität war dieser andere Teil an mir, der mir Freude machte, der mir erlaubte, meinen Körper zu umarmen – wenn auch behutsam – anstatt ihn zu fürchten, die Schmerzen zu fürchten, die er mir bereitete, ein unwillkommenes Geschenk, das ich nicht ablehnen konnte.“
In seinen Zwanzigern schrieb er einen Roman, „Trying to Grow“, dessen Erfolg ihm ermöglichte, nach London zu gehen. Hier sollte er „eine ganz besondere Liebe“ finden – jemanden, der am Tourette-Syndrom litt, einem Leiden mit noch ungeklärten Ursachen, gekennzeichnet durch zwanghafte Bewegungen.2
Leider bleibt das Bedürfnis nach Liebe allzu vieler Menschen ungestillt, meist ohne Bezug zu ihrer charakterlichen Integrität oder ihren Tugenden. Bemerkenswert daran ist jedoch, dass Menschen mit Behinderungen oft von vornherein das Recht verweigert wird, an dieser ganz besonderen Lotterie des Lebens teilzunehmen.
Im Westen entstand deshalb ein ganzer Berg von zorniger Literatur gegen die Unterstellung, Menschen mit Behinderungen wären asexuell, gegen den Ausschluss vom Sexualkundeunterricht in der Schule, gegen den „Schutz“ vor solchen Dingen durch selbsternannte „BeschützerInnen“ (wenn etwas infantilisierend ist, dann wohl das), gegen falsche Informationen über die Fähigkeit zu sinnlichem Genuss, falls ein Körper nicht der „Norm“ entspricht, gegen Einschränkungen der reproduktiven Rechte und die allgemeine Missbilligung von Beziehungen. Spart euch diesen Mist, lautet kurz gesagt die Botschaft vieler behinderter Menschen, die in reichen Ländern leben und über ihre Erfahrungen geschrieben haben. Diese Haltung ist das Ergebnis eines Kampfes, der herkulischer Anstrengungen bedurfte. Aber in armen Ländern herrscht völliges Schweigen.
Nicht dass Liebe – und ihr sexueller Ausdruck – für behinderte Menschen in armen Ländern kein dringendes Bedürfnis wäre. Wie könnte es auch anders sein? Aber zu viele Menschen scheinen zu glauben, dass es darauf nicht ankäme oder dass es sich um etwas Beschämendes handle, das behinderte Menschen unterdrücken sollten. Wem das unmenschlich erscheint, der hat schon begriffen, worum es geht. Aber es mag sein, dass Liebe und gelebte Sexualität hinter Bedürfnissen zurückstehen müssen, die noch dringender sind.
Bei einem Aufenthalt in England lernte Samuel Kabue eine behinderte Frau kennen, die sich bei ihm darüber beklagte, dass sie ihr „Essen auf Rädern“ nie rechtzeitig bekam. „Das war für sie eine Verletzung des Rechts, zur richtigen Zeit zu essen. (…) Ich sagte ihr, dass es in meinem Land nicht darauf ankäme, ob das Essen mitten in der Nacht oder wann auch immer gebracht würde, sondern dass es zu jeder Zeit höchst willkommen wäre. Viele unserer behinderten Menschen verbringen mehrere Tage ohne Essen, und selbst wenn sie eines bekommen, ist das kaum das, was man als ‚Essen‘ bezeichnen würde. Wenn berichtet wird, dass irgendwo in Afrika Menschen an Hunger sterben, dann sind behinderte Menschen schon lange vorher gestorben.“1
Behinderte Menschen sind auch unverhältnismäßig arm. In Ländern, wo Armut nicht im Geringsten „relativ“ zu verstehen ist, nimmt sie ihnen all jene Chancen, die ihnen die Mehrheit ohnehin vorenthalten will. Etwa 82 Prozent aller behinderten Menschen in armen Ländern leben unter der Armutsgrenze. Die Weltbank sagt, dass „eine halbe Milliarde behinderter Menschen zweifellos zu den Ärmsten der Armen gehören“ – von geschätzten 600 Millionen insgesamt.3 Überleben ist oft ihr dringendstes Problem. Die Sterblichkeit behinderter Kinder liegt in manchen Ländern bei 80 Prozent. Niemand weiß, wie viele von ihnen ermordet wurden.
Für „Behinderung“ gibt es eine ganze Reihe von Definitionen. Organisationen von Behinderten akzeptieren jedoch nur einen einzigen Grundsatz: Bei Behinderung geht es nicht um die damit verbundenen körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigungen, sondern um die von Vorurteilen bestimmte Reaktion der Gesellschaft. Es geht um die Kritik an einer Gesellschaft, die versucht, Menschen mit Behinderungen auszuschließen, sie in ihren Lebenschancen einzuschränken und zu benachteiligen, anstatt die Vielfältigkeit und Gleichwertigkeit der Menschen anzuerkennen. Wird ein Mensch aufgrund von Vorurteilen in einem Flüchtlingslager ans Ende der Schlange gezwungen oder wird ihm oder ihr in einer Situation des Mangels die Nahrung verweigert, kann das ein Todesurteil sein.
Menschen mit Behinderungen stehen oft vor enormen gesellschaftlichen Schranken, insbesondere in armen Ländern, wo der Kampf für ihre Rechte in der Regel noch keine lange Tradition hat.
Was müsste getan werden, um diese Schranken zu beseitigen? Ein UN-Ausschuss, beraten von mehreren Behindertenorganisationen, befasste sich mit der Ausarbeitung eines „Umfassenden und integrativen internationalen Übereinkommens über den Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen“.
Eine Reihe vernünftiger Grundsätze wurde darin formuliert: Würde, persönliche Autonomie einschließlich der Freiheit, Entscheidungen selbst zu treffen, und Unabhängigkeit der Person; Nichtdiskriminierung; vollständige und wirksame Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen als gleichwertige BürgerInnen und TeilhaberInnen der Gesellschaft; Respekt vor der Unterschiedlichkeit und Akzeptanz von Behinderung als Teil der menschlichen Vielfältigkeit und Menschlichkeit; Chancengleichheit und Barrierefreiheit.
Das sieht nach dem richtigen Weg aus – nur haben die USA in altbewährter Weise angedeutet, nicht unterzeichnen zu wollen und ermutigen andere Länder, es ihnen gleich zu tun. Außerdem haben auch ärmere Länder bereits zu verstehen gegeben, dass sie Probleme haben könnten, die nötigen Mittel aufzutreiben, um ihre behinderten BürgerInnen bei der Verwirklichung ihrer Lebenschancen zu unterstützen. Das Argument mit den fehlenden Mitteln ist zwar stichhaltig. Allerdings ist zu fragen, ob es nicht bloß als Rechtfertigung jener Ungleichbehandlung dient, die von der Gesellschaft routinemäßig praktiziert wird.
Eine Gesellschaft benötigt jedenfalls erheblichen Druck, bevor es zu spürbaren Veränderungen kommt. Kambodscha etwa hat den weltweit zweithöchsten Anteil an behinderten Menschen (nach Angola), ein Erbe des jahrelangen Kriegs und der verbreiteten Verwendung von Landminen. Man hätte erwarten können, dass die erst in letzter Zeit zunehmende Häufigkeit von Körperbehinderungen auch zu einer entsprechenden gesellschaftlichen Reaktion führt. Doch die kambodschanische Gesellschaft hielt weiter an der Vorstellung eines „schlechten Karmas“ fest, der Idee, Behinderungen wären die Folge von Sünden, die in früheren Leben begangen wurden. Was das im Alltag bedeutet, schildert Oum Phen, ein junger Überlebender einer Minenexplosion: „Die Leute behandelten mich nicht wie einen Menschen. Sie sahen auf mich herab, weil ich meine eigene Familie nicht ernähren konnte.“
Als behinderte Menschen begannen, sich in Selbsthilfegruppen zu organisieren (dazu ermutigt unter anderem von der britischen Organisation „Action on Disability and Development“), hatten neue Mitglieder oft den Eindruck, dass sie keine Chance hätten, die Gesellschaft zu verändern. Aber gemeinsam konnten sie dieses Vorurteil überwinden, indem sie Qualifikationen erwarben, mit denen sie Geld verdienen konnten. Sie konzentrierten sich auch auf potenziell einflussreiche Personen: Etwa überredeten sie buddhistische Mönche, in ihre Predigten gegen die Macht des „schlechten Karmas“ über die Gesellschaft auch wissenschaftliche Erklärungen von Behinderungen einzuflechten.3
Zwar ist es sehr begrüßenswert, dass Verbände behinderter Menschen in armen Ländern aktiv werden und sich mit Behindertenorganisationen rund um die Welt verbünden. Doch der Kampf um Selbstbestimmung ist ein millionenfacher, es ist der Kampf jedes einzelnen Menschen auf dem Hindernisparcours der Gesellschaft. Wer in einem armen Land mit einer schweren Behinderung zur Welt kommt, wird gut möglich nie eine Schule von innen sehen, geschweige denn darüber entscheiden, ob es eine „integrative“ oder eine „Sonderschule“ sein soll. Betroffene Kinder werden vielleicht von den Eltern vor der Außenwelt versteckt, laufen eher Gefahr, körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht zu werden. Wer seine Meinung nicht mit Worten ausdrücken kann, dem oder der wird oft unterstellt werden, keine zu haben. Man wird vielleicht von „ExpertInnen“ Programmen zur Förderung der „Eigenständigkeit“ unterworfen, egal, wie unzweckmäßig sie sind, und ohne Rücksicht auf das Recht, von anderen abhängig zu sein. Wer das alles übersteht und ein eigenständiger Mensch wird, bekommt es dann noch mit all jenen zu tun, die einen gönnerhaft als „Helden“ oder „Heldin“ abfeiern.
Im Kern handelt es sich bei dieser Haltung um Mitleid. Samuel Kabue dazu: „Mitleid hat eine eigene Dynamik. Der, dem es bezeugt wird, wird nicht nur als jemand betrachtet, der schlechter dran ist als der, der Mitleid zeigt, sondern auch als minderwertig.“1 Ein Slogan der Bewegungen im Westen trifft es besser: „Mitleid, Nein Danke.“
Menschen mit Behinderungen müssen sich auf einen mühsamen Kampf einlassen, wenn sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben erlangen und durchsetzen wollen, dass ihre Entscheidungen von jenen respektiert werden, die vorgeben, auf ihrer Seite zu stehen. Nur auf Basis eines solchen Respekts kann echte Partnerschaft entstehen. Das gilt auch für den Kampf um Behindertenrechte. Vor einem Vierteljahrhundert befasste sich eine Konferenz von „Rehabilitation International“, einer weltweiten Gruppierung von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Regierungsstellen, mit der Endfassung ihrer Charta. Sie war als Aufruf an Regierungen gedacht, die Gleichberechtigung behinderter Menschen sicherzustellen. Die schwedische Delegation schlug vor, dass behinderte Menschen 51 Prozent der Mitglieder des Leitungsgremiums von Rehabilitation International stellen sollten. Der Vorschlag wurde abgewiesen.
Was dann passierte, schildert Jim Elder-Woodward, einer der Anwesenden: „Als diese Entscheidung bekanntgegeben wurde, brach die Hölle los. Etwa 200 behinderte Menschen nahmen an der Konferenz teil, aus Amerika, Australien, Afrika, Asien – von überall her, selbst aus den hintersten Winkeln Europas. Niemand konnte die Doppelzüngigkeit dieser ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen und VertreterInnen von Regierungen und NGOs verstehen (…). In dieser Nacht herrschte Hochspannung. Um 23 Uhr trafen sich behinderte Menschen in einem Nebenraum. Nichts war organisiert, es gab keine Tagesordnung, keinen Vorsitz – bloß eine wütende Menge behinderter Menschen, die in Gruppen miteinander redeten und im Raum hin und her schwirrten. Dann ergriff Ed Roberts das Wort. Ed hatte Kinderlähmung, und damals hatte ihn Reagan noch nicht als Director of Rehabilitation für Kalifornien gefeuert. Er saugte an seinem Sauerstoffzylinder, ganz wie Harold Wilson an seiner Pfeife, und begrüßte die lärmende Menge mit dem Ruf: ‚Krüppel aller Länder, vereinigt euch!‘“
„Ein gewaltiges Zustimmungsgebrüll toste auf, und dann wurde es still, während Ed über die Notwendigkeit sprach, eine separate internationale Bewegung behinderter Menschen aufzubauen. Ich habe weder zuvor noch danach eine derart mitreißende Energie gespürt wie von dieser ambitionierten, wütenden Menge behinderter Menschen. Sie waren aus allen vier Ecken der Welt hergekommen und hatten keine Lust, sich von einem Haufen von Quacksalbern und Büroexistenzen beiseite schieben zu lassen.“4
So wurde Disability Peoples‘ International (DPI) geboren, eine Bewegung für alle Behinderten. Im Lauf der Jahre trennten sich einige Gruppen von DPI. Ihre Führung sei zu stark von RollstuhlfahrerInnen dominiert, wurde argumentiert. So begannen die Weltblindenunion und der Weltverband der Gehörlosen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Die Zersplitterung der Behindertenbewegung gab Anlass zu Besorgnis. Debatten, Meinungsverschiedenheiten und interne Zwistigkeiten gibt es weiterhin. Man könnte es auch Demokratie nennen. Mittlerweile ist eine noch größere internationale Organisation entstanden, die alle von Behinderten geführten oder für ihre Interessen arbeitenden Weltverbände zusammenfasst, die International Disability Alliance.
Während diese großen Verbände auf internationaler Ebene aktiv sind und etwa UN-Unterorganisationen drängen, mehr zu tun, sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit geradezu reflexhaften Vorurteilen konfrontiert. Behinderte Menschen haben keine andere Wahl, als ihren Kampf um die Erziehung der Gesellschaft fortzusetzen. Wann es uns endlich dämmern wird, dass gleiche Rechte für behinderte Menschen keine „Sonderrechte“ sind, weiß niemand.
Bis dahin werden in diesem Kampf, der auch als „der letzte Bürgerrechtskampf“ bezeichnet wird, manchmal auch Verzweiflungstaten nötig sein. So wie jene von Antonio Diaz, der sich von seinem Rollstuhl mitten auf eine vielbefahrene Schnellstraße in Port of Spain, der Hauptstadt Trinidad und Tobagos warf, um gegen seine Arbeitslosigkeit zu protestieren. Die Autos wichen ihm aus, er war in den Schlagzeilen, aber nichts geschah. Nach 116 Tagen hatte er genug Wirbel ausgelöst, um den Premierminister zu zwingen, in Sachen Arbeitsplätze für Behinderte umzudenken und ihm einen Job in der staatlichen Getreidemühle anzubieten. Der Kampf geht weiter.
Copyright New Internationalist
1) Arne Fritzson und Samuel Kabue, Interpreting Disability, WCC Publications, Genf 2004
2) Broken bones and broke heart, BBC News, 5.7.2005,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4640847.stm3) Calum MacLeod, Land mine citims saved by a sense of purpose, The Independent, 13. Dezember 2001
4)
www.leeds.ac.uk/disability-studies