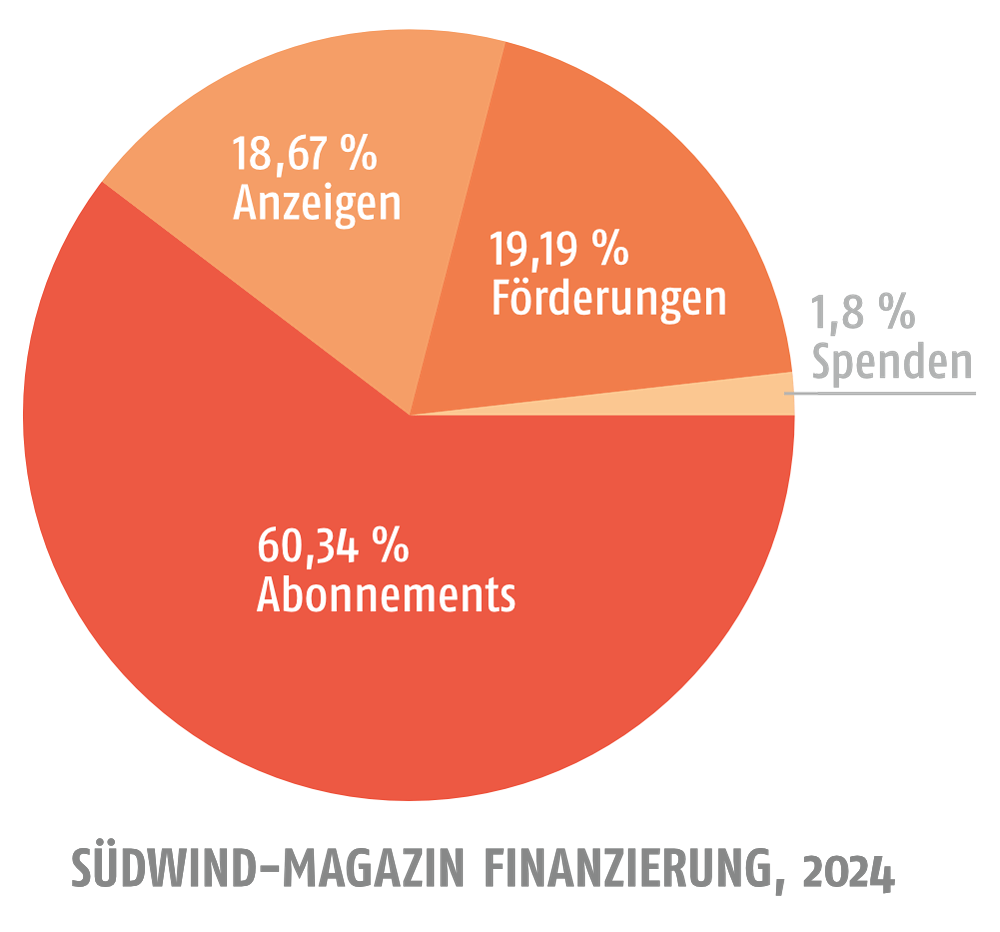Es könnte ein schöner Traum sein: Eines der ärmsten Länder der Welt, hoffnungslos unterentwickelt aber mit erheblichen natürlichen Reichtümern gesegnet, findet einen Weg, diese sozialverträglich auszuschöpfen und damit die schreiende Armut seiner Bevölkerung zu beenden. Tschad, vor Jahrzehnten noch wegen seines Elefantenreichtums von SafaritouristInnen als Geheimtipp gepriesen, fördert seit drei Jahren Erdöl. Ein weltweit einmaliges Regelwerk sollte die vernünftige Verwendung der Öleinnahmen garantieren. Aber vom Wirtschaftsaufschwung in den Statistiken spürt die Bevölkerung wenig, und rivalisierende Begehrlichkeiten um die Verfügungsgewalt über Ölgelder haben das Land zum Kriegsschauplatz gemacht. Unter dem autokratischen Präsidenten Idriss Déby bringt die Regierung nach und nach sämtliche Säulen des Ölmodells Tschads zum Einsturz.
Débys jüngster Vorstoß kam im August, als er den Rauswurf von zweien der drei ausländischen Ölkonzerne ankündigte, die im Tschad die Ölförderung leisten. Chevron aus den USA und Petronas aus Malaysia, die jeweils 35 und 25 Prozent des internationalen Ölkonsortiums im Tschad halten, sollten sich zurückziehen und ihre Anteile der staatlichen Ölgesellschaft SHT (Société des Hydrocarbures du Tchad) übergeben. Einzig ExxonMobil aus den USA war von Débys Ansinnen nicht betroffen. Als größte Teilhaberin des Konsortiums ist sie auch die einzige, die über ihre lokale Filiale Esso-Tchad aktiv vor Ort Förderung betreibt.
Tschad warf Chevron und Petronas angebliche Steuerschulden in Höhe von rund 380 Millionen Euro vor. Das sind mehr als die jährlichen Staatseinnahmen des Landes. Wohl nicht zu Unrecht witterten die US-Amerikaner und Malaysier einen Erpressungsversuch, zumal die SHT erst auf dem Papier existiert. Die Erpressung funktionierte. Am 6. September sagten die beiden Konzerne mehr als 223 Mio. Euro an Nach- und Vorauszahlungen zu. Daraufhin blies Tschads Regierung den Rauswurf ab. Doch das Ansinnen, eine eigene staatliche Ölfirma an die Stelle der ausländischen Investoren zu setzen, bleibt. Am selben Tag vereinbarte Tschads Ölminister Emmanuel Nadingar mit seinem Amtskollegen aus Algerien die Mitwirkung der staatlichen algerischen Ölfirma Sonatrach, eines der größten Staatsunternehmen Afrikas, bei der Gründung der SHT, mit Option auf einen algerischen Einstieg in Tschads Ölindustrie.
Der tschadische Präsident will offenbar langfristig die beste Einnahmequelle seines Landes komplett in den Griff bekommen. Mit den Ölgeldern hat es Déby geschafft, sein Gefolge bei Laune zu halten und sich gegen immer zahlreichere Rebellengruppen zu wehren. Diese sind mit militärischer und finanzieller Unterstützung aus Sudan im Osten des Tschad aktiv und rückten Mitte April sogar bis in die Hauptstadt Ndjamena vor. Nur weil sie dort das kaum benutzte Parlamentsgebäude für den Präsidentenpalast hielten und es fleißig und vergeblich beschossen, während die Regierung mit logistischer Hilfe aus Frankreich die Rebellen längst eingekesselt und isoliert hatte, scheiterte dieser Umsturzversuch.
Aber seit einigen Wochen wird im Osten wieder gekämpft, und die Opferzahlen gehen selbst nach Angaben der Regierung in die Hunderte. Tschadische Rebellen, Janjaweed-Milizen aus dem benachbarten Darfur, sudanesische Darfur-Flüchtlinge zu Hunderttausenden, Hilfswerke zwischen den Fronten und französisches Militär an der Grenze – Osttschad ist zu einem der unübersichtlichsten und explosivsten Krisenherde Afrikas geworden. Es geht um die Macht in einem Land, das längst nicht mehr wegen seiner Elefanten geschätzt wird, sondern wegen seines Ölreichtums und seiner strategischen Stellung im Herzen des Kontinents.
Als Tschads Regierung, internationale Ölkonzerne und die Weltbank Ende der 1990er Jahre darüber verhandelten, unter welchen Bedingungen die Ölförderung im Süden des Landes aufgenommen und eine Pipeline zum Export an den Atlantik durch Kamerun gebaut werden könnte, war das Land noch ein Labor für Weltverbesserer. Um die 3,7 Milliarden US-Dollar Investitionskosten zu mobilisieren, stimmte die Weltbank 1999 auf Druck internationaler Nichtregierungsorganisationen zu, den Tschad zu einem einzigartig komplizierten Geflecht von Kontrollen über die Verwendung seiner Öleinnahmen zu zwingen. Der Bau der 1.070 Kilometer langen Pipeline wurde mit strengen Auflagen versehen, ein Gerüst zivilgesellschaftlicher und internationaler Gremien zur Kontrolle der Öleinnahmen entstand. Als ab Oktober 2003 das Öl endlich zu fließen begann, trat das Ende 1998 verabschiedete tschadische Ölgesetz 001 in Kraft, das die Verwendung der Ölgelder genau festlegte: Fünf Prozent für die Förderregion selbst, 15 Prozent für den Staatshaushalt, und die restlichen 80 Prozent für genau definierte „prioritäre Sektoren“ wie Bildung und Gesundheit, wovon wiederum ein Zehntel in ein Londoner Sperrkonto namens „Zukunftsfonds“ geleitet wurde.
Eigentlich ging es dabei nur um Brosamen: 25 Jahre sollen die Ölquellen nach ihrem bis jetzt bekannten Umfang sprudeln. Dafür kann der Tschad nach ursprünglicher Prognose lediglich zwei Milliarden Dollar Öleinnahmen erwarten. Gestiegene Ölpreise und höhere Fördermengen ließen die Erlöse zwar bereits wesentlich höher ausfallen als prognostiziert. So verdiente der Staat bis Ende 2005 am Öl schon 335 Millionen Dollar, und seine Einnahmen haben sich seit 2002 mehr als verdoppelt. Aber von den gesamten Einnahmen aus der Ölförderung fließen offiziell nur 12,5 Prozent als Abgaben an den tschadischen Staat, und nur dieser Teil ist den genannten Festlegungen unterworfen. Weitere informelle Staatseinnahmen, wie die bei neuen Vertragsabschlüssen üblichen Bonus-Zahlungen der Ölfirmen an die Regierung, bleiben unkontrolliert. Doch machen die informellen Einnahmen in der Praxis mehr aus als die formellen. Auch gilt das Ölgesetz von 1998 nicht für noch zu entdeckende Ölquellen.
Die Beschwerde der Regierung Déby, sie habe ihre Souveränität eingebüßt, klang somit hohl, zumal die ersten Vorauszahlungen der Ölkonzerne an die Regierung 2003 flugs verschwanden und später in Form von Waffen sowie Hubschraubern für den Präsidentensohn wieder auftauchten. Die Unfähigkeit der Weltbank, das zu verhindern, sorgte schon damals für breiten Protest. Die für die Kontrolle der Ölgelder zuständigen Gremien konnten Vertragsbrüche nur beanstanden, doch nichts dagegen unternehmen.
Es war aber nicht die nationale und internationale Zivilgesellschaft, die das Ölmodell Tschad zum Einsturz brachte, sondern Tschads Regierung selbst. Am 29. Dezember 2005 verabschiedete das regierungstreue Parlament das Ölgesetz 002, das alle früheren Vereinbarungen über den Haufen schmiss. Der „Zukunftsfonds“ wurde ersatzlos abgeschafft. Die „prioritäten Sektoren“, bisher auf Armutsbekämpfung beschränkt, wurden um das Militär und die Territorialverwaltung erweitert, und der Präsident erhielt die Vollmacht, sie per Dekret jederzeit neu definieren zu können. Ihre Ansprüche auf die Ölerlöse wurden von 80 auf 70 Prozent verringert, während der ohne Einschränkung für den Staatshaushalt reservierte Anteil von 15 auf 30 Prozent verdoppelt wurde.
In Reaktion suspendierte die Weltbank am 6. Januar 2006 ihre Tschad-Kredite. Als Präsident Déby das Gesetz am 11. Januar trotzdem ratifizierte, sperrte die Weltbank am Folgetag das Londoner Bankkonto, auf dem sämtliche Öleinnahmen des Tschad landen. Es folgten einige Monate Sprachlosigkeit, in denen Déby während seiner Belagerung durch Rebellen sogar drohte, die gesamte Ölförderung einzustellen, wenn er nicht endlich das Geld zum Waffenkauf verwenden dürfte. Wenig später, am 27. April, knickte die Weltbank ein und akzeptierte sämtliche tschadischen Änderungen – mit Ausnahme der Klausel, wonach auch das Militär ein „prioritärer Sektor“ sein soll.
Dass wenige Monate später Déby gegen die Ölfirmen eine zweite Front eröffnet, zeugt von der Hartnäckigkeit eines Regimes, das mit steigendem Wohlstand auch politische Beschränkungen immer weniger akzeptiert, obwohl sein Überleben vom Wohlwollen der alten Kolonialmacht Frankreich sowie der Ölfördermacht USA abhängt. Tschads Opposition hat die Weltbank immer zur Unnachgiebigkeit gegenüber Déby aufgefordert. Débys früherer Ölminister Tom Erdimi, der 1999 die Weltbankvereinbarungen mit aushandelte, ist jetzt sogar Chef einer der Rebellengruppen. Dies zeigt, wie sehr das Ölmodell auch zum innenpolitischen Zankapfel geworden ist.
Davon, dass der Tschad im Umgang mit seinem Ölreichtum für andere afrikanische Länder ein Vorbild darstellen könnte, redet heute niemand mehr. Vielmehr ist er ein Lehrbeispiel dafür geworden, wie internationale Regelwerke zu Fall gebracht werden können.