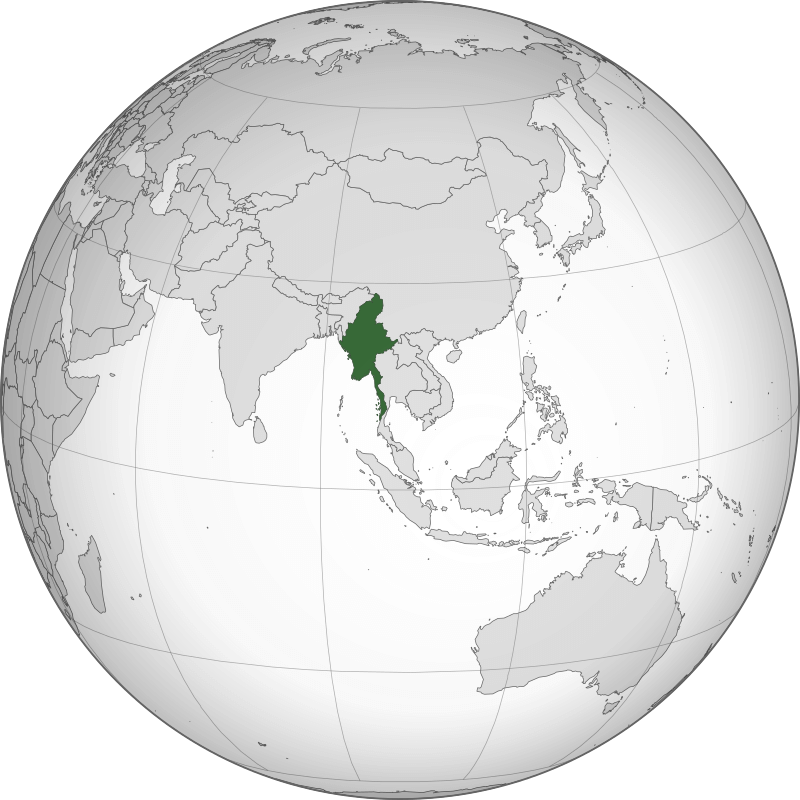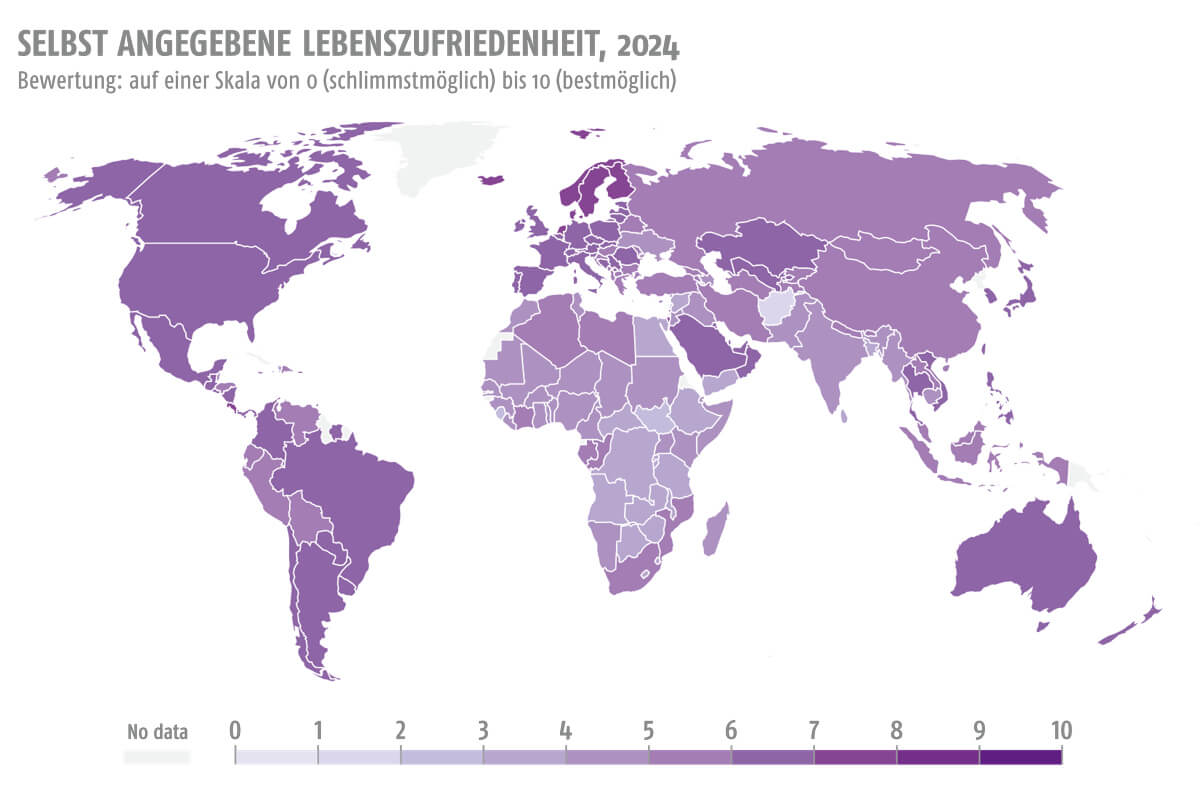
Armutszeugnis für den Norden
Fehlende Investitionsanreize und politisches Desinteresse verhindern, dass die überlegene Forschungskapazität der reichen Länder zur Lösung der Gesundheitsprobleme des Südens eingesetzt wird. Nun wird ein neuer Anlauf genommen – mit Hilfe reicher Philanth
Einen Grund dafür nennt Ok Pannenborg, Afrika-Gesundheitsexperte der Weltbank: Die Preisstruktur bei Medikamenten entspricht immer weniger dem Bedarf der Mehrheit der Weltbevölkerung. Besonders krass zeigt sich dies im Falle von vergleichsweise sündteuren Therapeutika für die Immunschwächekrankheit AIDS, die sich gerade im ärmsten Kontinent Afrika epidemisch ausbreitet und die Ausmaße einer auch wirtschaftlichen Katastrophe annehmen dürfte. Selbst einen einzigen Fall von Schlafkrankheit zu behandeln, kostet mit 700 US$ mehr als sich die meisten betroffenen Länder leisten können.
Jedoch beschränkt sich das Problem nicht auf zu teure Medikamente. Für typische Krankheiten der Armen wie Malaria, an der laut WHO 1998 rund 1,1 Millionen Menschen zugrunde gingen, gibt es wenig effektive Gegenmittel, weil einfach zu wenig Geld in entsprechende Forschung und Entwicklung (F&E) fließt. Dies ist ein generelles Phänomen: Von den 50 bis 60 Milliarden US-Dollar, die weltweit pro Jahr für medizinische Forschung ausgegeben werden, entfallen nur 10 Prozent auf die Lösung der Gesundheitsprobleme von 90 Prozent der Weltbevölkerung.
Was unmoralisch erscheinen mag, bezeichnen Ökonomen als „Marktversagen“: Es zahlt sich für private Pharmakonzerne nicht aus, entsprechende F&E vorzufinanzieren, da die potentiellen Kunden kein oder zu wenig Geld haben. Im allgemeinen wird ein Produkt erst dann ins Auge gefasst, wenn mit einem jährlichen Umsatz von 300 Millionen US-Dollar gerechnet werden kann, sagen Branchenanalytiker.
Dass Medikamente so teuer sind, liegt dagegen an einem politischen Eingriff in den Markt, dem Patentrecht. Erfindern neuen nützlichen Wissens wird ein zeitlich beschränktes Monopolrecht auf seine Verwertung garantiert, um eine Wiedergewinnung der Entwicklungskosten plus Gewinn zu ermöglichen und die fortgesetzte Innovationstätigkeit sicherzustellen. Die Folge: Pharmaprodukte werden jahrelang zu Preisen verkauft, die weit über ihren unmittelbaren Produktionskosten liegen.
Mangels internationaler Regulierung war es Pharma-Unternehmen in Entwicklungsländern jedoch lange Zeit möglich, zur Selbsthilfe zu greifen und viele der benötigten Medikamente ohne Lizenz selbst zu produzieren, während sich Regierungen anderer armer Länder bei ihnen weit billiger als beim ursprünglichen Hersteller versorgten, Medikamente „parallel importierten“, wie es im Fachjargon heißt.
Was dann geschah, war Wissenstransfer nach dem Geschmack der reichen Länder: Anstatt den armen Ländern im Sinne der Entwicklungszusammenarbeit mit Finanzmitteln unter die Arme zu greifen oder die entsprechende Forschung vorzufinanzieren, wurde alles daran gesetzt, die Entwicklungsländer von den Vorzügen des westlichen Patentrechts zu überzeugen. Das kostet vergleichsweise wenig und entspricht den Wünschen der eigenen Pharmaindustrie, den erwähnten Abhilfemaßnahmen einen Riegel vorzuschieben.
Und so sieht das Abkommen über handelsbezogene geistige Eigentumsrechte (TRIPS) von 1994 vor, dass alle Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO einen verbindlichen Mindestschutz von Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten gewähren müssen. Ob die Pharmamultis damit ihre Gewinne tatsächlich erhöhen, ist angesichts der oft fehlenden Kaufkraft im Süden fraglich; der Schaden für die Kranken dagegen garantiert.
TRIPS bietet allerdings weiter ein Schlupfloch, da im öffentlichen Interesse in Notlagen Produkte auch zwangslizenziert oder parallel importiert werden dürfen. Dies wird mittlerweile nicht nur von der WHO, sondern auch von der Weltbank befürwortet, während etwa der US-Ökonom Jeffrey Sachs überhaupt die Sinnhaftigkeit von TRIPS in Frage stellt. Von der betroffenen Pharmabranche – und damit von den reichen Ländern – wird das allerdings nicht goutiert: Als Südafrika entsprechende Gesetze verabschiedete, drohten die USA Pretoria mit der Anrufung der WTO, und man einigte sich auf nicht näher bekannte Alternativen.
Was sich derzeit abzeichnet, ist ein Versuch, die fehlende globale Gesundheitspolitik durch neue Initiativen internationaler Organisationen und privater Sponsoren zumindest ansatzweise zu ersetzen. Die 1999 gegründete „Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung“ (GAVI) ist eine dieser Initiativen, der neben WHO, Weltbank oder dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF auch der internationale Dachverband der Pharmazeutischen Industrie (IFPMA) und – als bislang wichtigster Geldgeber – die „Bill and Melinda Gates Foundation“ angehören.
Die Stiftung des reichsten Ehepaars der Welt wird GAVI innerhalb von fünf Jahren 750 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen. Ebenfalls beteiligt sind die Rockefeller Foundation und einzelne Regierungen, während die UN-Foundation des Medienmoguls Ted Turner ähnliche Initiativen unterstützt. Und immerhin: Bill Clinton, Präsident der von Budgetüberschüssen geplagten reichsten Nation der Erde, hat zugesagt, sich für 50 Mio. US-Dollar Unterstützung für GAVI einzusetzen, und im US-Kongress gibt es Initiativen für Steuererleichterungen für F&E zugunsten der armen Länder.
Unmittelbare Ziele von GAVI sind die Beschaffung von Medikamenten und Impfstoffen unter dem Marktpreis sowie die Förderung von F&E in die Vorbeugung etwa von Malaria, Tuberkulose und AIDS. Letzlich geht es aber darum, „Gesundheitsfragen ins Zentrum der weltweiten Entwicklungsagenda“ zu rücken, so Brundtland. Dies ist auch die Aufgabe einer mit 15 renommierten Ökonomen besetzten Kommission unter Vorsitz von Jeffrey Sachs, die binnen zwei Jahren unter anderem darlegen soll, auf welche Weise Investitionen in Gesundheit wirtschaftliches Wachstum fördern und Armut und Ungleichheit verringern. Dass dies überhaupt für erforderlich gehalten wird, stellt den politischen Entscheidungsträgern allerdings ein Armutszeugnis aus. Ein geschlossenes Auftreten der Entwicklungsländer wie zuletzt bei der WTO-Ministerkonferenz in Seattle, diese Vermutung sei gewagt, dürfte überzeugender ausfallen.
Mit rund 50 Prozent hat die Anwendung medizinischen Wissens weit mehr zur Erhöhung der Lebenserwartung in Entwicklungsländern beigetragen als die Zunahme des Einkommens. Rechnet man noch Effekte durch bessere Information der Frauen hinzu, steigert sich der Beitrag von informations- und wissensbezogenen Faktoren auf rund 80 Prozent.