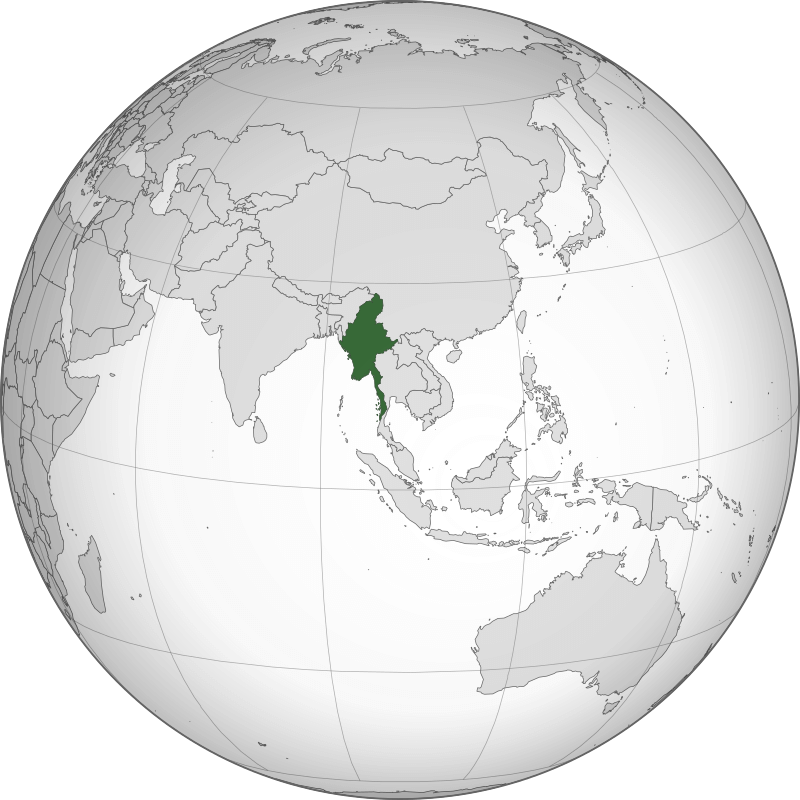Der antike Kalender der Mayas teilt die Zeit in größere Abschnitte ein als die gregorianische Zeitrechnung. Gegenwärtig befinden wir uns am Ende eines solchen Zeitabschnitts. Die Mayas in Guatmala fürchten sich aber mehr vor einer Zerstörung ihrer Lebensumwelt als vor dem Weltuntergang.
Die von den Mayas berechnete Zeitenwende am 21. Dezember 2012 – das Ende des 13. Baktun – wird von europäischen Medien zum Anlass genommen, über eine angebliche Prophezeiung des Weltuntergangs zu spekulieren.
Die meisten Mayas in Guatemala sehen diese Debatte mit großer Gelassenheit. Maria Mateo, eine Bäuerin aus dem Mayavolk der Popcomchí, glaubt jedenfalls nicht, dass das Ende der Welt bevorsteht. „Es wird einen Wandel geben, aber nicht an einem bestimmten Datum. Das Volk der Mayas und vor allem die Frauen müssen sich solidarisch zusammenschließen, Kräfte bündeln und gemeinsam für unsere Mutter Erde kämpfen.“
Der Sozialwissenschaftler Virgilio Alvarez, Direktor der lateinamerikanischen Fakultät für Sozialwissenschaften FLACSO, meint, die Medien der westlichen Welt hätten den Maya-Kalender zum Anlass für eine exotisierende Berichterstattung genommen. „Noch immer werden die Mayas romantisch verklärt, als arme, wilde Indios, die man unterstützen muss. Gleichzeitig ist die Solidarität mit den indigenen Völkern Lateinamerikas verloren gegangen, besonders in Europa.“
Spirituelle Führer der guatemaltekischen Mayabevölkerung haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Sorgen für das neue Zeitalter formuliert: „Unsere Berge, Wälder und Flüsse werden von großen Firmen gestohlen, die Wasserkraftwerke bauen, Bergbau betreiben oder Monokulturen anlegen. Wir sehen die Ankunft dieser Konzerne wie einen Rückschritt in die Kolonialzeit. Unsere natürlichen Reichtümer werden geraubt, unsere Rechte werden verletzt, genauso wie vor 400 Jahren, als der 13. Baktun begann.“
Große, gelbe Schaufelbagger graben eine Straße durch die grüne Vegetation und den fruchtbaren Urwaldboden des guatemaltekischen Hochlands. Wo noch vor kurzem Bäume standen, die nie von Menschenhand berührt wurden, fallen jetzt heiße Sonnenstrahlen auf schattenlose Abhänge, über die eine staubige Schotterpiste führt. Der siebzehnjährige Juan Toma blickt auf eine zerfurchte Landschaft. Parallel zu der Sandpiste verläuft ein breiter Wasserkanal aus Zement. Das moderne Bauwerk schlängelt sich über viele Kilometer bis zu einem Auffangbecken, dessen Wasser schon bald die Turbinen eines Kraftwerks antreiben soll. „Das Projekt hat uns auch Vorteile gebracht“, sagt Juan. „Wir haben jetzt eine Straße, auf der Autos fahren. Früher mussten wir alle großen Lasten selber schleppen. Das war hart. Heute können wir auf einen Pickup warten, unsere Säcke auf die Ladefläche legen, den Fahrer bezahlen und bis zum Markt mitfahren, um dort unsere Produkte zu verkaufen.“
Der Weg führt vorbei an Hängen, die erst vor kurzem abgeholzt wurden. „Früher war hier überall Wald“, erzählt Juan. „Dann hat der Konzern die Straße gebaut. Seither werden auf großen Flächen tausende Bäume gefällt.“
Das Wasser aus den Bächen und Rinnsalen, die früher den Fluss Xeputul gespeist haben, landet jetzt in dem Kanal. Die Menschen, die unterhalb des Kraftwerks wohnen, fürchten, das regelmäßige Ablassen großer Wassermengen aus dem Auffangbecken könnte zur Unterspülung ihrer Hänge führen und schließlich Erdrutsche mit katastrophalen Folgen auslösen.
Auch die Maisfelder und Gemüsegärten des Jungen liegen auf einem der gefährdeten Grundstücke. „Mein Land ist nah am Fluss. Was wird passieren, wenn der Druck des Wassers alles kaputt macht? Wo soll ich dann meine Produkte anbauen? Was soll ich dann essen?“
Juan hat guten Grund, besorgt zu sein. In Guatemala kommen Jahr für Jahr dutzende, manchmal hunderte Menschen bei Erdrutschen ums Leben. Wenn in den Bergen eine neue Straße angelegt wird, achtet offenbar niemand auf die Erosion, die dadurch ausgelöst wird. Oft dauert es nicht lange, und die Erde der Umgebung gerät in Bewegung.
Juan wohnt in der Siedlung Wachalal. Das Wort bedeutet „Kamerad“ in der Mayasprache K'iche'. Die Hütten der vierzehn Familien liegen etwa drei Kilometer entfernt von den Turbinen des Wasserkraftwerks. Der Fußweg dorthin führt über matschige Trampelpfade. Nach einer halben Stunde glitzern die ersten hellen Flecken im Grün des Dschungels. Es ist das Licht der Mittagssonne, die sich auf rostfreien Dächern spiegelt. Vor kurzem hat der italienische Konzern ENEL, der das Wasserkraftwerk baut, den BewohnerInnen von Wachalal einen Stapel nagelneuer Wellblechplatten geschenkt, als Geste guter Nachbarschaft.
Das Schulgebäude von Wachalal ist eine einfache Hütte aus Brettern, zusammengebundenen Ästen und Wellblech. In dem einzigen Klassenraum stehen zwei Dutzend blau gestrichene Stühle aus Metall. Ansonsten ist die Ausstattung ziemlich provisorisch. Beim Erläutern von Multiplikationsaufgaben helfen Steine und getrocknete Waldbeeren. Der gegenwärtige Lehrer ist frustriert über die Situation des Mangels: „In der Schule haben wir eine Tafel, Stühle, Tische und ein paar Bücher. Sonst nichts. Eigentlich bräuchten wir viel mehr Bücher.“
Der Lehrer hat beobachtet, wie sich die Umgebung von Wachalal rasant verändert. Er glaubt nicht, dass der Bau des Kraftwerks eine Verbesserung für die Lebenssituation der Familien mit sich bringen wird: „Die Leute aus dem Ausland kommen hierher, um Geld zu verdienen. Für die Menschen vor Ort bringt das keine Vorteile.“
Während der Planungsphase des Projekts wurden die betroffenen Gemeinden nie informiert. Erst als die Bagger mit dem Graben begonnen hatten, führte ENEL eine Informationsveranstaltung durch. In einem PowerPoint-Vortrag auf Englisch, der für das Publikum aus den Mayavölkern der K'iche' und Ixil synchron ins Spanische übersetzt wurde, pries ein italienischer Repräsentant der Geschäftsführung die saubere Energieproduktion der Wasserkraft. Danach flog der Mann mit einem Hubschrauber Richtung Hauptstadt. Die Menschen, die in dem Gebiet wohnen, fragte er kein einziges Mal nach ihrer Meinung.
Die Hütten der Familien in Wachalal bestehen meist nur aus einem Raum mit zwei oder drei Holzbetten ohne Matratzen. Auf jedem Bett schlafen bis zu sechs Personen. Manche Kinder liegen in Hängematten oder auf dem blanken Erdboden.
Der Familienvater Chico Lopez fürchtet, dass der Bau des Wasserkraftwerks zu einer Zerstörung der Lebensgrundlage der Menschen in Wachalal führen könnte. Vor ein paar Jahren hat er schon einmal erlebt, wie seine Hütte und Äcker durch einen großen Erdrutsch zerstört wurden. „Der Tropensturm Stan hat mein Haus mitgenommen“, erzählt er. „Mein Grundstück ist in eine Schlucht gerutscht. Dort kann ich jetzt nichts mehr anbauen. Wir leben in ständiger Angst. Wenn es lange regnet, denke ich immer nur: Mein Gott, lass es nicht wieder geschehen.“
Von den Behörden in der Provinzhauptstadt erwartet Chico Lopez keinerlei Unterstützung. Er weiß aus Erfahrung, dass sich dort niemand für die Sorgen einer kleinen Mayagemeinde wie Wachalal zuständig fühlt. Besonders dann nicht, wenn diese Sorgen auf einen Konflikt mit einem kapitalstarken ausländischen Konzern wie ENEL hinauslaufen.
Das Kraftwerk wird bald große Mengen Elektrizität produzieren, die in das nationale Stromnetz eingespeist wird. Doch bei den Menschen in Wachalal wird davon nichts ankommen. Die meisten gehen schon bald nach Sonnenuntergang ins Bett. Doch wirklich still wird es auch dann nicht. Im Tal des Xeputul haben tausende Grillen ihr Konzert angestimmt.
Andreas Boueke stammt aus Deutschland und lebt seit zehn Jahren als freier Journalist und Buchautor in Guatemala.