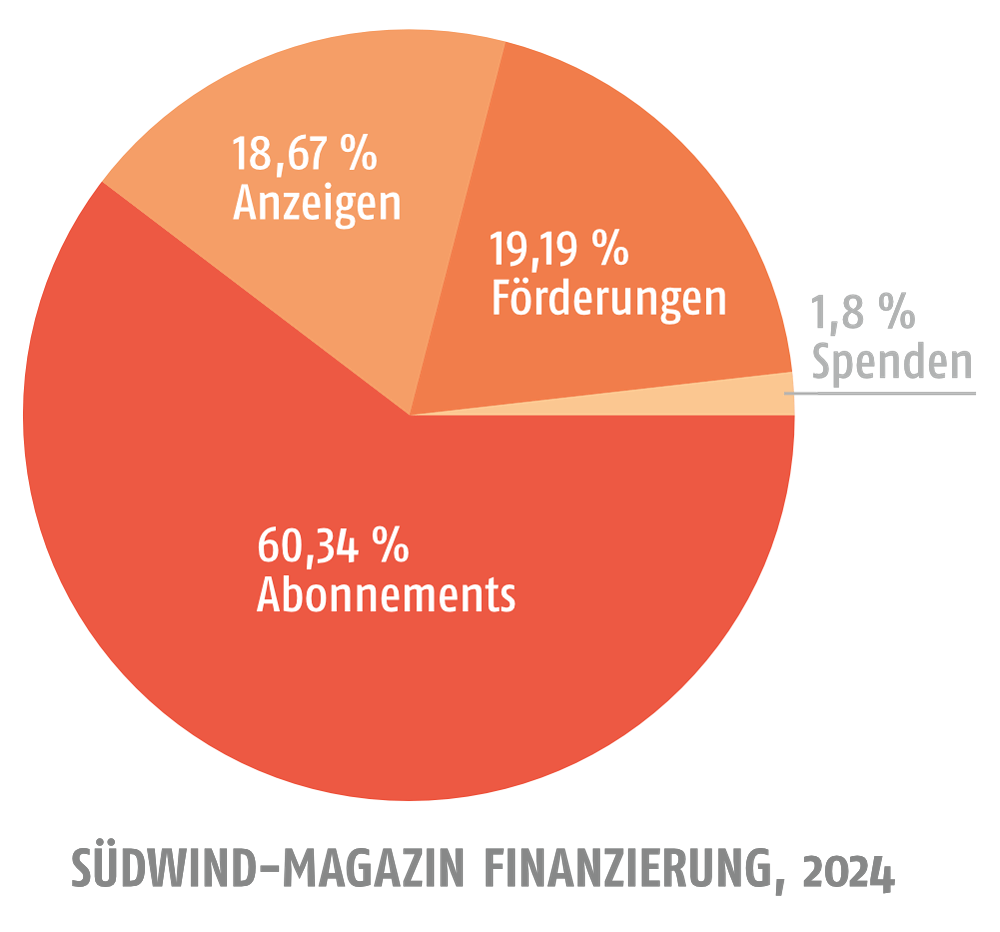Biologisch hergestelltes Soja könnte eine Lebensgrundlage für
Hunderttausende Kleinbauern in Brasilien darstellen.
Derzeit werden die Exportchancen nach Europa sondiert.
Etwa 20 Frauen und Männer jäten ein Soja-Feld im Inneren des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Vor 15 Jahren gehörte das Land einem reichen Großgrundbesitzer. Dann besetzten es 1.500 Landlose und die Regierung war gezwungen, die bis dahin ungenutzte Farm zu enteignen. Die BesetzerInnen gründeten Produktionsgemeinschaften, bauten Grundnahrungsmittel wie Bohnen oder Mais und auch Exportprodukte wie Soja an. Zunächst lief das „konventionell“ mit viel Dünger und Pestiziden, so der Landarbeiter Jurandir Grosseli. Aber dann habe man gemerkt, dass die Gifte Mensch und Umwelt stark beeinträchtigen. Also stellten sie auf Bio-Soja um.
„Das ist billiger, man braucht weder Kunstdünger noch Agrargifte“, erklärt der 40-jährige Familienvater und rechnet vor, dass die Bauern und Bäuerinnen pro Hektar Bio-Soja umgerechnet 15 Euro für die Saat ausgeben. Der konventionelle Sojaanbau koste 70 Euro – für Pestizide, Dünger und Saatgut. „Rausgeschmissenes Geld“, ergänzt ein Kollege. „Wir zahlen kein Geld mehr an multinationale Konzerne für deren Gifte. Das nutzen wir für Arbeitskräfte auf dem Acker.“
Ob der Weg Erfolg verspricht, ist unklar. Doch alle sind optimistisch. Beraten werden die Neu-Biobauern von einer Kreditgenossenschaft, die von der deutschen Caritas gefördert wird. Erste Handelswege nach Europa wurden aufgetan und müssen jetzt getestet werden. Biolandwirtschaft ist in Brasilien wenig bekannt, aber immer mehr Biobauern – vor allem im Süden – setzen auf ein erhöhtes Verbraucherbewusstsein in Europa.
Dazu zählt auch Inácio Maletz, der mit seiner fünfköpfigen Familie in Marechal Rondon im Bundesstaat Paraná zehn Hektar biologisch bebaut – mit Soja und mit Mais, Gemüse oder Früchten für die eigene Küche. Statistisch gesehen hat der Nachfahre deutscher Einwanderer kaum eine Chance. Denn viele Kleinbauern geben hier auf. Allein in den vergangenen zehn Jahren verließen eine Million ihre Äcker. Über fünf Millionen landlose Familien irren auf der Suche nach einem Stückchen Erde durch Brasilien – Folge einer einseitigen Unterstützung der bisherigen Regierungen für den großflächigen Anbau von Exportprodukten wie etwa Soja, das zur Zeit einen wahren Boom erlebt.
Seit BSE-Krise und Tiermehlverbot in Europa exportiert Brasilien die Hülsenfrucht in Mengen wie nie zuvor. Mit dem Plan „Avança Brasil“ will man die Sojafläche von 14 Mio. Hektar gar verdreifachen. Schon breiten sich Soja-Felder wie ein Flächenbrand in den subtropischen und tropischen Norden aus. Investoren, die kaum Menschen einstellen, sondern mit Maschinen säen und ernten und mit Flugzeugen schädliche Pestizide versprühen, bekommen schnell hohe und billige Staatskredite und neues Land.
Wer wie Inácio Maletz auf Pestizide verzichtet, wird kaum unterstützt. „Kredite für Bio-Anbau gibt es nicht“, schimpft er. „Die verlangen, dass du teuren Kunstdünger und Gifte benutzt.“ Aber das wollte Maletz nicht und stellte auf „Bio“ um. Geholfen hat ihm dabei das „Zentrum zur Unterstützung von Kleinbauern“ (Capa), das von der Lutherischen Kirche Brasiliens und dem deutschen Evangelischen Entwicklungsdienst gefördert wird.
80 Familien unterstützt „Capa“ in der Gemeinde Marechal Rondon. „Meistens sind es Kleinbauern, die ohne uns ihre Äcker verlassen hätten“, so Capa-Berater Waldir Luckmann, der auf eine vielseitige Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen, Hühnern und einen reichhaltigen Gemüse- und Obstanbau wert legt: „Besonders wichtig ist, dass sich die Leute zusammenschließen. Die gegenseitige Hilfe macht sie stark.“
Die Ware der Bauern wird im unternehmenseigenen Labor genau überprüft. Bio-Soja darf keine chemischen Rückstände enthalten. Dafür erhalten die Landwirte einen weitaus besseren Preis. Für viele Kleinbauern sei das eine echte Alternative, so der Geschäftsführer. Das halte die Leute auf dem Land.
Ist Bio-Soja also eine Hoffnung für Kleinbauern in Brasilien? „Ja“, meint Professor Enrique Ortega, Agrar- und Ernährungswissenschaftler der Universität Campinas (Bundesstaat São Paulo). Ortega befasst sich seit Jahren mit Soja und sieht im expandierenden konventionellen Soja-Anbau einen großen Arbeitsplatzvernichter. Sollte Brasilien zudem, wie es derzeit aussieht, auf Gen-Soja umstellen, würden nur wenige tausend Menschen im Soja-Sektor eine Arbeit finden. Denn Gen-Soja müsse nur einmal mit einem speziellen Herbizid besprüht werden. Das verringere die Zahl der Arbeitskräfte enorm. „Mit diesen neuen Technologien würde der ländliche Raum in Brasilien zu einer leblosen Wüste mit wenigen Arbeitsplätzen“, warnt Ortega. „Vergleichbar mit den Soja-Regionen der USA.“
Wenn auf der bisherigen Soja-Fläche jedoch Bio-Soja von Kleinbauern angebaut würde, könnte Brasilien 500.000 Arbeitsplätze schaffen, prophezeit der Wissenschaftler: „Die großflächige Agrarwirtschaft schafft nur Arbeitslose. Und sie ist abhängig von Importgütern wie Saatgut, Dünger und Maschinen. Das macht Brasilien auch politisch enorm abhängig vom Ausland.“
Eine Umstellung ist aber nur schwer möglich, dessen ist sich Professor Ortega bewusst. Die Macht multinationaler Konzerne ist zu groß. Außerdem: Wenn sich die Produktion im Süden wandeln solle, müsse der Norden seine Ernährungsgewohnheiten verändern.
Diese Aufforderung hat die Evangelische Akademie Loccum bei Hannover aufgegriffen. Vor zwei Jahren wurde das „Dialogprojekt Soja“ gegründet, das die Beteiligten am Sojahandel zueinander bringen will. (Näheres siehe www.loccum.de/aktuell.) Mitarbeiterin Kerstin Lanje macht sich jedoch keine Illusionen: „Die Chancen für Bio-Soja im Lebensmittelbereich sind sehr groß. Problematisch wird es dagegen bei der Hühner- und Schweinemast, in der in Deutschland 500.000 Tonnen brasilianischer Sojaschrot verfüttert werden.“
Zwar hat die Ökonomin Sojabauern, Mühlenbesitzer, Handelsunternehmen und hiesige Landwirte mehrmals mit Umwelt- und Entwicklungsgruppen zusammen gebracht. Doch schnelle Lösungen sind nicht zu finden. Bio-Soja von Kleinbauern bedeutet einen höheren Preis. „Und noch will den niemand zahlen“, sagt Lanje. Wenn dieser Weg überhaupt möglich sei, dann nur durch Nachhaltigkeitskriterien etwa der Europäischen Union.
Der Autor ist freiberuflicher Journalist und Buchautor und lebt in Bielefeld, Deutschland.