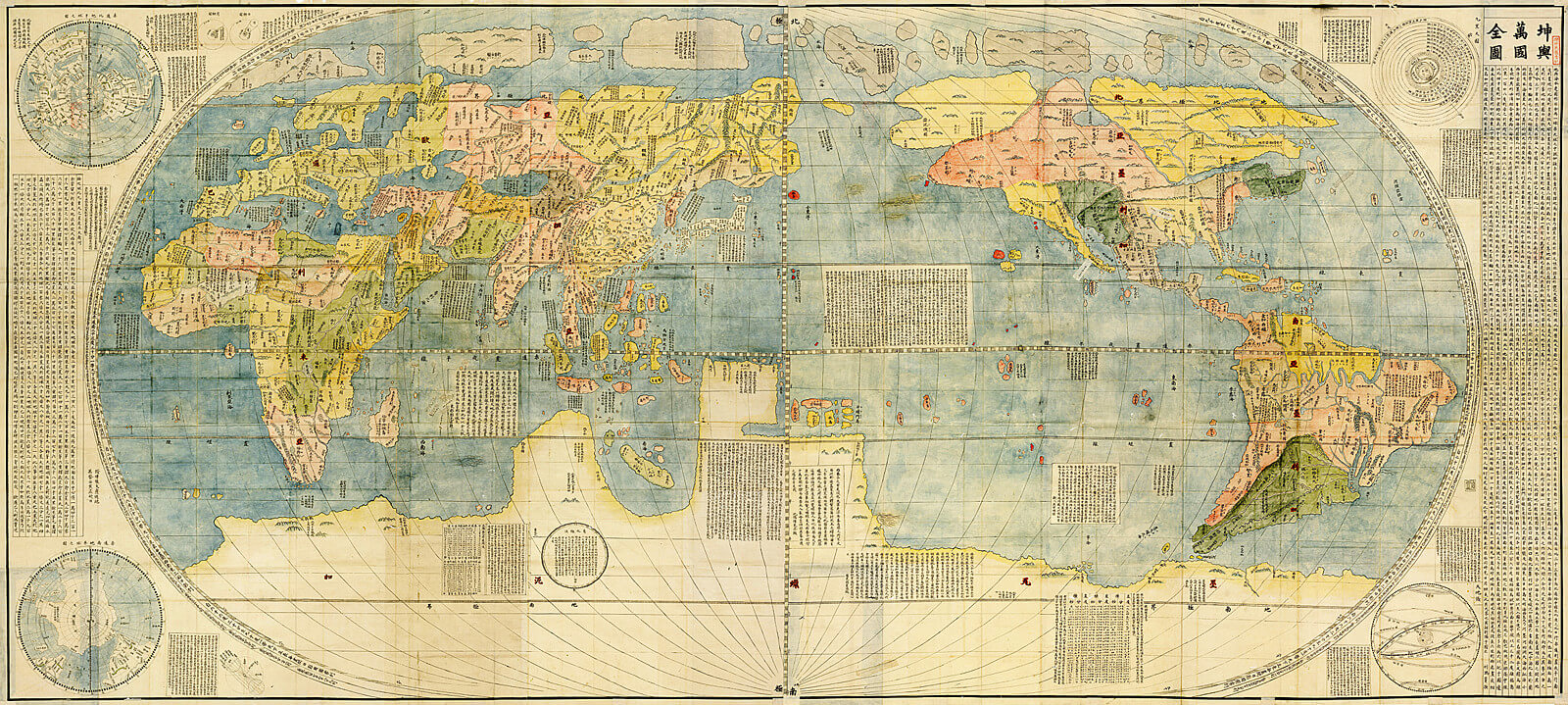
Über 300 namenlose Gräber auf dem Friedhof von Santa Cruz de Tenerife sind stille Beweise der restriktiven Einwanderungspolitik Europas. Von Afrika aus versuchen ImmigrantInnen in Holzbooten auf die 140 Kilometer entfernten Kanarischen Inseln zu gelangen. Viele kommen dabei ums Leben.
Sie stellte sich vor eines der Gräber am Friedhof Santa Lastenia. Es war nicht wie die anderen, nicht geschmückt mit rosa Plastikblumen, kleinen Messingkreuzen und Sprüchen, die ein besseres Leben nach dem Tod versprechen. Kein in goldener Schönschrift gehaltener Name zierte das Grab. Eine blassgelbe Styroporplatte und ein wenig Mörtel mussten ausreichen. Mit rosa Lippenschrift schrieb sie einen Namen auf das gelbe Styropor.
Armanzios Stimme wird leise, wenn er erzählt, was er eines Tages beobachtet hat. Als Totengräber lebt er von und mit der Trauer. Zwei Mal hat ihn seine Arbeit auf dem Friedhof berührt. Als er ein Kind begraben musste und eine schwarze Frau mit Lippenstift einen Namen auf eines der Gräber schreiben sah.
Tage zuvor hatte sie an einem der Strände im Süden der Kanareninsel Teneriffa mit Lichtsignalen ihren Bruder auf die rettende Küste aufmerksam machen wollen. Er war in einem der hunderten, tausenden Holzboote unterwegs gewesen, die sich von den Küsten von Senegal, Mauretanien und Marokko Richtung vermeintlich besseres Leben aufmachen. Sein Schiff hatte die Orientierung verloren. Per Handy versuchte die Schwester, ihm den Weg zu weisen. Vergeblich, am nächsten Tag fischte die Küstenwache den Bruder tot aus dem Wasser.
Seine letzte Ruhestätte fand er unter den knallrot blühenden Flammenbäumen des Friedhofs Santa Lastenia in Santa Cruz, der Hauptstadt vonTeneriffa. In rosa Schrift geschrieben stand der Name des Bruders auf dem Grab. Bis zum ersten Regen, dann war es wie die anderen rund 300 Gräber, die mit Styroporplatten verschlossen sind: namenlos. Meistens sind es Männer aus Westafrika, die auf dem Weg nach Europa verunglückt sind. Niemand weiß, wie viele nie wieder das Wasser verlassen.
Teneriffa stellt den tot Geborgenen ein Grab auf Santa Lastenia zur Verfügung. Fünf Jahre lang, dann werden die Überreste in einem gelben Plastikcontainer in ein Massengrab geworfen. Alle, deren Familien nicht zahlen können, landen hier.
Der Friedhof liegt am Meer, gleich neben den vielen Stränden, an denen jedes Jahr sonnenhungrige EuropäerInnen urlauben. An einem dieser Strände saß eines Tages Jessica. Es ist Februar, der Himmel leicht bewölkt und das Wetter mild und angenehm. Sie hat sich ein Buch des kanarischen Journalisten und Schriftstellers José Naranjo mitgenommen, der seit Jahren seine InselmitbewohnerInnen über die Folgen der Festung Europa aufklärt. Jessica liest das Buch „Cayuco“, wie die kleinen Holzboote auf Spanisch heißen, auf denen die meisten afrikanischen ImmigrantInnen auf die Kanarischen Inseln kommen. Als sie einen Moment von ihrem Buch aufblickt, sieht sie genau das: ein Cayuco mit schwarzen Menschen, das am Strand zum Stillstand kommt. Sie denkt nicht weiter nach: Sie zieht ihr T-Shirt aus, ihren Minirock, legt sie den Ankommenden um die Schultern und versucht so gut es ging – im Bikini – die erschöpften Menschen zu versorgen. Immer mehr Menschen vom Strand laufen herbei, um den AfrikanerInnen ihre Handtücher um die Schulter zu legen. Einer fragt nur „Europa?“. Ein anderer fängt an zu weinen. Nach acht Tagen Überfahrt waren sie endlich – lebend – am Festland angekommen.
Kurz darauf kommt Nicolás mit seinem Team vom Roten Kreuz. Krankenschwestern und Freiwillige versuchen, den Ankömmlingen das Notwendigste zu geben: Kleidung, Wasser, heißen Tee und Kekse. Ein Psychologe führt mit den Leuten erste Gespräche. Die meisten verstehen kein Spanisch, viele sprechen nur das senegalesische Wolof.
Am nächsten Tag meldete sich Jessica als Freiwillige beim Roten Kreuz und gehört seitdem zum Notfallteam von Nicolás, das an der Südküste Teneriffas, in Las Galletas sein Büro hat. Dort wartet man auf Nachrichten der Küstenwache, die normalerweise die Holzboote der ImmigrantInnen schon vor dem Aufsetzen am Strand abfängt. Manchmal rufen auch DorfbewohnerInnen oder TouristInnen an, die, wie Jessica, plötzlich ein Boot voller AfrikanerInnen vor sich sehen. „Das Härteste für mich ist nicht, wenn ein Mensch nur noch tot geborgen werden kann“, sagt Nicolás. „Das Härteste ist, wenn ein Überlebender nach seinem Bruder fragt, den niemand gesehen hat. Wenn einer fragt, ob in dem anderen Schiff eine Frau mit Baby war und ich das verneinen muss.“
Eine politische Meinung zu Immigration vertritt der Kanare nicht. Ihm gehe es um die Menschen. Er wolle, dass sie überleben. „Wenn ich nach Hause gehe, spiele ich mit meinem Sohn“, sagt er. „Da interessiert mich Politik nicht.“ Soviel entschlüpft ihm aber doch: „Migration ist ein Menschenrecht.“
Von diesem Recht haben auch Beyat, Issa und Ibra Gebrauch gemacht. Genüsslich saugen die drei jungen Senegalesen an ihren Strohhalmen. Sie trinken Coca Cola bei McDonalds in einem Vorort von Santa Cruz, der mit seinen unzähligen Einkaufszentren und Zubringerstraßen wie ein Disneyland des Konsums wirkt. Beyat und Issa haben bei McDonalds Arbeit gefunden. In Issas Dorf wüssten die meisten nicht, dass in Europa das Geld nicht auf der Straße liegt. „Wenn du viel Geld verdienen willst, musst du viel arbeiten“, sagt er. Und das tut er jetzt. Das Gehalt bei McDonalds reicht gerade fürs Überleben und um ein paar Euros nach Hause zu schicken.
Die KollegInnen an der Fritteuse beginnen, mit Beyat zu scherzen. Er ist meistens gut drauf, spricht fließend Spanisch mit dem typisch weichen Akzent der Kanaren und sorgt für gute Stimmung. Seit kurzem lässt er sich Dreadlocks wachsen, die wie kleine Stacheln von seinem Kopf abstehen. Aber meistens trägt er sowieso seine rote Baseball-Kappe. Verkehrt herum natürlich – wie die großen Rap-Vorbilder aus den USA. Denn nach dem Pommes-Frittieren widmen sich Beyat, Issa und Ibra ihrer wahren Leidenschaft: der Musik. „Wir arbeiten hart bei McDonalds, um zu überleben. Aber hart an unserer Musik, um zu leben“, sagt Beyat.
Die internationalen Medien lieben die jungen Rapper: junge Immigranten, die nicht in Selbstmitleid zergehen, sondern harte Texte mit Musik unters Volk bringen. Sogar die BBC hätte schon ein Interview mit ihnen gemacht. Zusammen sind sie die Rap-Gruppe Famille Bou Bess, die neue Familie – das, was sie in der Fremde am dringendsten brauchten.
Vor vier Jahren, mit 16, kamen sie in einem Holzboot auf Teneriffa an. Beyats Nacken war komplett verbrannt. Acht Tage lang war er in der gleichen Position gesessen, ohne sich bewegen zu können. Jeder Schritt auf dem kanarischen Strand tat ihm weh.
Die Vergangenheit hat Famille Bou Bess jedoch hinter sich gelassen. Auf den Friedhof Santa Lastenia sind sie noch nie gegangen. Die anonyme Bestattung und die Styroporplatten machen sie trotzdem wütend. „Bei einem Begräbnis im Senegal wäre die ganze Familie, das ganze Dorf anwesend. Alle würden beten, um dem Toten die besten Wünsche auf seine Reise mitzugeben.“ Issa schüttelt den Kopf. Vielleicht gäbe es diesen Friedhof ja gar nicht. Bis jetzt habe er nur Gerüchte darüber gehört.
Doch Santa Lastenia ist real und spiegelt die Realität: 400 neue Gräber hat die Stadt Santa Cruz gebaut – an den billigsten Plätzen des Friedhofs. Man rüstet sich für die Immigration. Doch auch die InselbewohnerInnen rüsten sich für die ImmigrantInnen – vielleicht anders als man denken würde. Für Nicolás und sein Team ist es keine Seltenheit, dass sie zu einem Notfall an den Strand gerufen werden und bereits das halbe Dorf am Strand versammelt ist, um die afrikanischen Ankömmlinge zu versorgen. Einmal hätte eine alte Frau sich ihre weiße Schürze umgebunden und mitten am Strand einen großen Topf heiße Schokolade gekocht. Ein anderes Mal habe ein Dorf Tische und Stühle an den Strand getragen und ein Festmahl aufgetischt. Das Rote Kreuz hat dem ganzen Dorf einen Preis für Menschlichkeit verliehen.
Südwind-Redakteurin Michaela Krimmer reiste im August nach Teneriffa. Die Reise war Teil des Projekts „Eurotours 2010“ der österreichischen Europapartnerschaft, bei der 26 JournalistInnen in 26 EU-Ländern zu Migration und Integration recherchierten (www.facebook.com/eurotours2010).
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.


