
Über offenen Rassismus im Sport wird viel diskutiert, über die Strukturen dahinter weniger. Wie Sportler:innen bis heute vom kolonialen Überlegenheitsdenken geprägt werden.
Es ist ein Muster im Sport: Bei rassistischen Vorfällen in Stadien gibt es mediale Aufmerksamkeit und Funktionär:innen versprechen Verbesserung – bis der Sturm der Entrüstung vorbeigezogen ist.
So geschehen in der spanischen Profifußballliga: „Rassismus ist in La Liga normal.“ Mit diesen Worten meldete sich der Fußballspieler Vinícius Júnior in den Sozialen Medien, nachdem er 2023 im Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Valencia von einem Fan rassistisch beleidigt worden war. „Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört heute den Rassisten“, schreibt Vinícius.
Der „Rassismus-Skandal“ gegen den brasilianischen Stürmer war daraufhin Thema in allen Medien, Politiker:innen solidarisierten sich mit Vinícius, der spanische Verbandspräsident Javier Tebas entgegnete, weder Spanien noch die Liga seien rassistisch. Auch der Weltverband Fifa meldete sich zu Wort. Präsident Gianni Infantino forderte ein „weltweites Stadionverbot für Rassisten“ und kündigte eine Arbeitsgruppe für den Umgang mit Diskriminierung an. Ein paar Wochen später war die öffentliche Aufregung wieder verstummt.
Rassistische Strukturen. In Österreich schaffte es im April 2023 sogar ein Nachwuchsteam von Austria Klagenfurt in die Tageszeitungen Der Standard und Kronen-Zeitung, weil ein Spieler von seinem Gegner rassistisch beschimpft wurde. Über die rassistischen Strukturen im Fußball wird hingegen wenig gesprochen. Der deutsche Autor und Sportjournalist Ronny Blaschke versucht, das zu ändern. Im Buch „Spielfeld der Herrenmenschen“ beschreibt er, wie die Kolonialgeschichte den Männerfußball noch heute beeinflusst.
„Dem Fußball liegt etwas total Gewalttätiges zugrunde“, sagt Blaschke im Gespräch mit dem Südwind-Magazin. „Mächte wie England, Deutschland oder Frankreich haben mithilfe des Fußballs verschiedene Bevölkerungsgruppen in ihren Kolonien gegeneinander aufgewiegelt.“ Vor allem aber haben sie generell „Menschenrassen“ erfunden – die Idee, dass es grundlegende genetische Unterschiede zwischen Menschen gebe, also zum Beispiel zwischen Schwarzen und Weißen.
Die Kolonialmächte begründeten so ihre vermeintliche Überlegenheit, ihren Anspruch auf Macht und Sklaverei. Heute ist die Rassentheorie widerlegt, ihre Idee ist aber in den Köpfen geblieben – auch im Fußball. „Es hält sich die Vorstellung des weißen Geists und des Schwarzen Körpers“, sagt Blaschke. „Es gibt Studien, die zeigen, dass die vermeintlich kreativen Positionen auf dem Fußballfeld überproportional von weißen Spielern besetzt werden und die kräftigen athletischen Positionen überproportional von Schwarzen.“
Weiße Trainer. Dass man noch heute besonders im Fußball an einen genetischen Vorteil von People of Color glaubt, zeigt die „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2023. Der Aussage „Schwarze Menschen sind im Sport besonders talentiert“ stimmten knapp die Hälfte der Befragten zu, die Mitglied in einem Fußballverein sind. Bei den Befragten anderer Sportvereine waren es 37 Prozent Zustimmung, bei denen ohne Mitgliedschaft 39 Prozent. Gleichzeitig glaubten 16 Prozent der Fußballmitglieder an die Aussage „Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt“. Nur vier Prozent der Befragten anderer Sportvereine gaben hier ihre Zustimmung.
Das spiegelt sich in den Führungsetagen des Fußballs wider. Während Spieler:innen mit Migrationshintergrund Normalität sind, sind Trainer:innen, Schiedsrichter:innen, Aufsichtsräte oder auch Journalist:innen in den europäischen Ligen mit wenigen Ausnahmen weiße Männer. „Ich habe oft von Schwarzen Fußballern erzählt bekommen, dass sie als Schüler animiert wurden, Fußball zu spielen. Nicht aber, Führungsaufgaben zu übernehmen“, sagt Blaschke.
Beispiel Schwimmen. Der Kolonialismus hat seine Auswirkungen auch auf andere Sportarten. In der amerikanischen Football-Liga NFL sind die Spielmacher größtenteils weiß, bei Langstreckenläufer:innen aus Afrika glauben noch viele Menschen an einen vermeintlich genetischen Vorteil.
Der Sportjournalist und frühere Leistungsschwimmer Martin Krauß widmet der Ausgrenzung von Athlet:innen sein Buch „Dabei sein wäre alles“. Er erklärt unter anderem, warum es heute noch kaum Schwarze Weltklasseschwimmer:innen gibt. Eigentlich sind Menschen aus Afrika sehr gut geschwommen. Im 16. Jahrhundert notierten westliche Reisende die für sie verblüffenden Schwimmfähigkeiten der Männer und Frauen. Sklavenhalter wollten diese Fähigkeiten aber unterbinden. Schwimmen war eine Möglichkeit, sich auf dem Wasser zu treffen und auszutauschen sowie ein Fluchtweg in die Freiheit.
In Europa verschwand das Schwimmen im Mittelalter. Nach und nach brachten sich die Europäer:innen das Schwimmen wieder bei – und verdrängten Schwarze.
Der US-amerikanische Historiker Jeff Wiltse wies nach, dass zwischen den 1940er- und 1960er-Jahren 90 bis 95 Prozent der weißen Schwimmer:innen öffentliche Bäder verließen, wenn Schwarze sie betraten. Auch erfand man vermeintlich wissenschaftliche Belege, warum Schwarze nicht gut schwimmen könnten: schwere Knochen, eine andere Muskelstruktur, ein ungünstig gelegener Körperschwerpunkt. In den USA können heute nur etwa halb so viele Schwarze wie Weiße schwimmen. Und die Erfolge von Schwarzen Profis sind schlecht dokumentiert.

Und für Frauen? „Der Frauen- und Mädchenfußball ist in Deutschland und Österreich sicherlich viel weißer“, sagt Nikola Staritz. Sie ist Politikwissenschaftlerin und setzt sich bei der Wiener Initiative Fairplay für Vielfalt und Antidiskriminierung im Sport ein. Frauen seien zuallererst von Sexismus betroffen, deshalb kämpfe der Fußball der Frauen erstmal um Anerkennung, stellt Staritz fest.
Und es fehlt an Vielfalt – nicht nur in den Führungsetagen. Es gibt wenige People of Color in den Frauen-Nationalteams von Österreich, Deutschland oder England.
Staritz von Fairplay ist selbst Trainerin im Mädchenfußball und glaubt, dass „tendenziell konservative Frauenbilder in gewissen Communities“ eine Rolle spielen. „Die Gruppen werden aber auch wenig angesprochen durch Kampagnen“, sagt sie. „Und wenn, sieht man immer blonde süße Mädels.“ Die Verbände seien zudem in der Bringschuld, andere Gruppen anzusprechen. „Vom ÖFB (Österreichischer Fußballbund, Anm. d. Red.) gibt es aber grundsätzlich keine Initiativen, Mädchen für den Fußball zu begeistern“, so Staritz.
Einen Platz, wo weder Religion noch Herkunft zählt, sondern nur, ob die Mädchen kicken können, hat Tuğba Tekkal mit dem Projekt Scoring Girls* geschaffen. Für die ehemalige Profispielerin kurdisch-jesidischer Abstammung war Fußball immer mehr als „nur“ Sport. Ihre Kindheit und Jugend waren von Diskriminierung und Rassismus geprägt, sagt sie gegenüber der deutschen Ausgabe der Vogue. Bis sie das erste Mal am Fußballplatz kicken durfte. Da habe sie das erste Mal gespürt: „Du bist hier richtig, du kannst etwas, du bist stark und frei.“ Dieses Gefühl möchte Tekkal seither Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte vermitteln, sie zusammenbringen und selbstbewusst machen. „Bei uns trainieren Mädchen, die ihre Heimat verlassen mussten, die Familienangehörige verloren haben, die über die gefährliche Mittelmeerroute nach Deutschland gekommen sind“, erzählt sie. Mittlerweile haben die Scoring Girls*-Projekte in Berlin und Köln über 150 Mädchen aus mehr als 15 Ländern erreicht. Auch im Irak sind die Scoring Girls* aktiv.
In Österreich setzt die Initiative „Kicken ohne Grenzen“ auf die integrative Kraft, die Fußball auch besitzt: u. a. Empowerment für Mädchen und Frauen. Einen sicheren Raum bietet die Initiative für junge Menschen aus benachteiligten Communities, u. a. für solche mit Fluchterfahrung. Eines ihrer Credos: „Abseits schulischer Bewertung sollen sich Jugendliche hier wertgeschätzt und zugehörig fühlen.“
Warum Vielfalt im Sport so wichtig ist? „You can’t be what you can’t see“, sagt Tekkal. Es braucht mehr Vorbilder und Sichtbarkeit, ist sie überzeugt.
Antirassismus als Idealismus. Um diese Vielfalt zu erreichen, sollten in das Fußballgeschäft eingreifende Regeln geschaffen werden. Autor Blaschke wünscht sich von den Verbänden genau das: „Es hilft uns nicht, Antirassismus weiter als Idealismus zu begreifen. Wir müssen Regeln aufstellen, Verpflichtungen und Sanktionen, die ein Gerüst bilden.“ Er fordert Diversitäts-Quoten in Führungsetagen, verpflichtende Lehrgänge in der Trainer:innen- und Schiedsrichter:innen-Ausbildung, Stipendien und Mentoring-Programme für People of Color.
Als Vorbild könnte die sogenannte Rooney-Rule aus dem American Football dienen. In der NFL sind die Klubs verpflichtet, mindestens zwei Kandidat:innen für Trainer:innen-Jobs oder die Führungsetage einzuladen, die eine Minderheit repräsentieren oder weiblich sind. 2019 wurde die Regel von der English Football League adaptiert, zu der die zweite, dritte und vierte Fußballliga in England gehören. Jedes Team muss seitdem eine:n Kandidat:in aus einer ethnischen Minder-
heit zum Vorstellungsgespräch einladen.
In den meisten europäischen Ligen gibt es solche Regeln nicht. Und sie werden nicht einmal diskutiert. Auch nicht, wenn Spieler wie Vinícius Junior von Real Madrid wiederholt rassistisch angefeindet werden. Dann bleibt es beim Rassismus-Skandal im Stadion und in den Medien. So lange, bis der nächste kommt.
Tobias Fries studiert Orientalistik an der Universität Wien und ist freier Journalist. Er schreibt über Sport, Gesellschaft und Politik.
Zum Weiterlesen
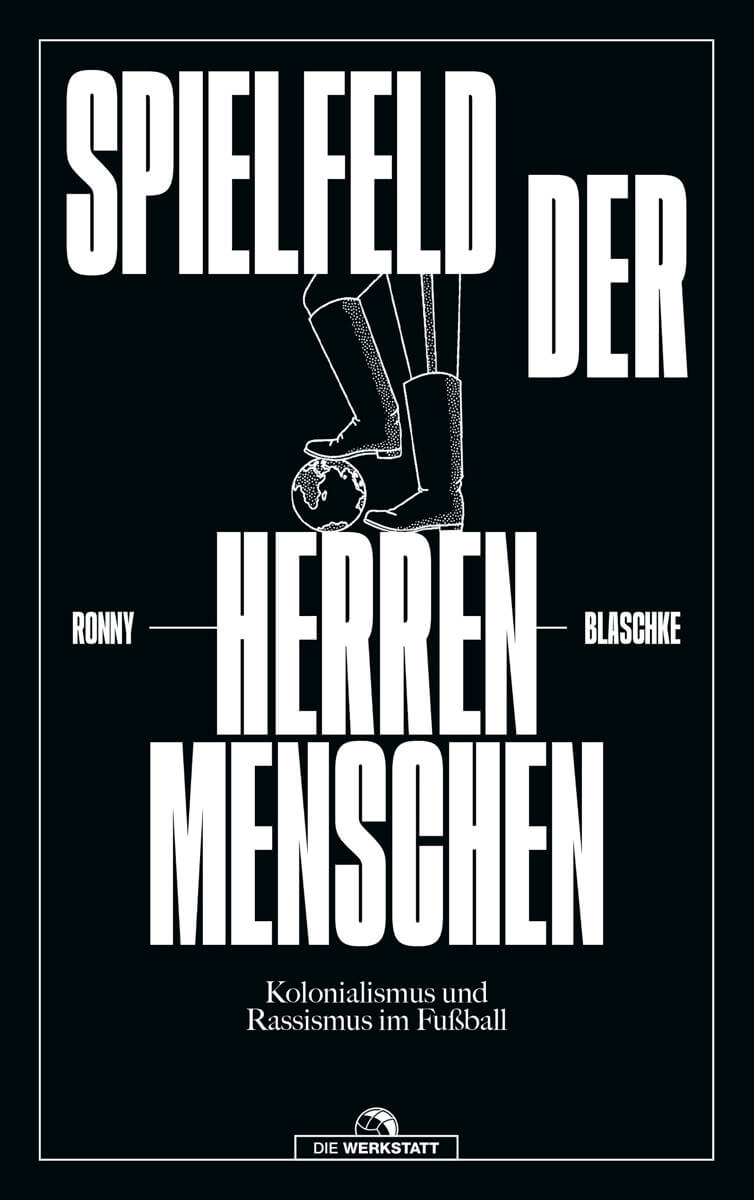
Ronny Blaschke:
Spielfeld der Herrenmenschen
Kolonialismus und Rassismus im Fußball.
Die Werkstatt, Bielefeld 2024, 256 Seiten, € 23,50

Martin Krauß:
Dabei sein wäre alles
Wie Athletinnen und Athleten bis heute gegen Ausgrenzung kämpfen. Eine neue Geschichte
des Sports.
C. Bertelsmann Verlag, München 2024, 448 Seiten, € 29,50







