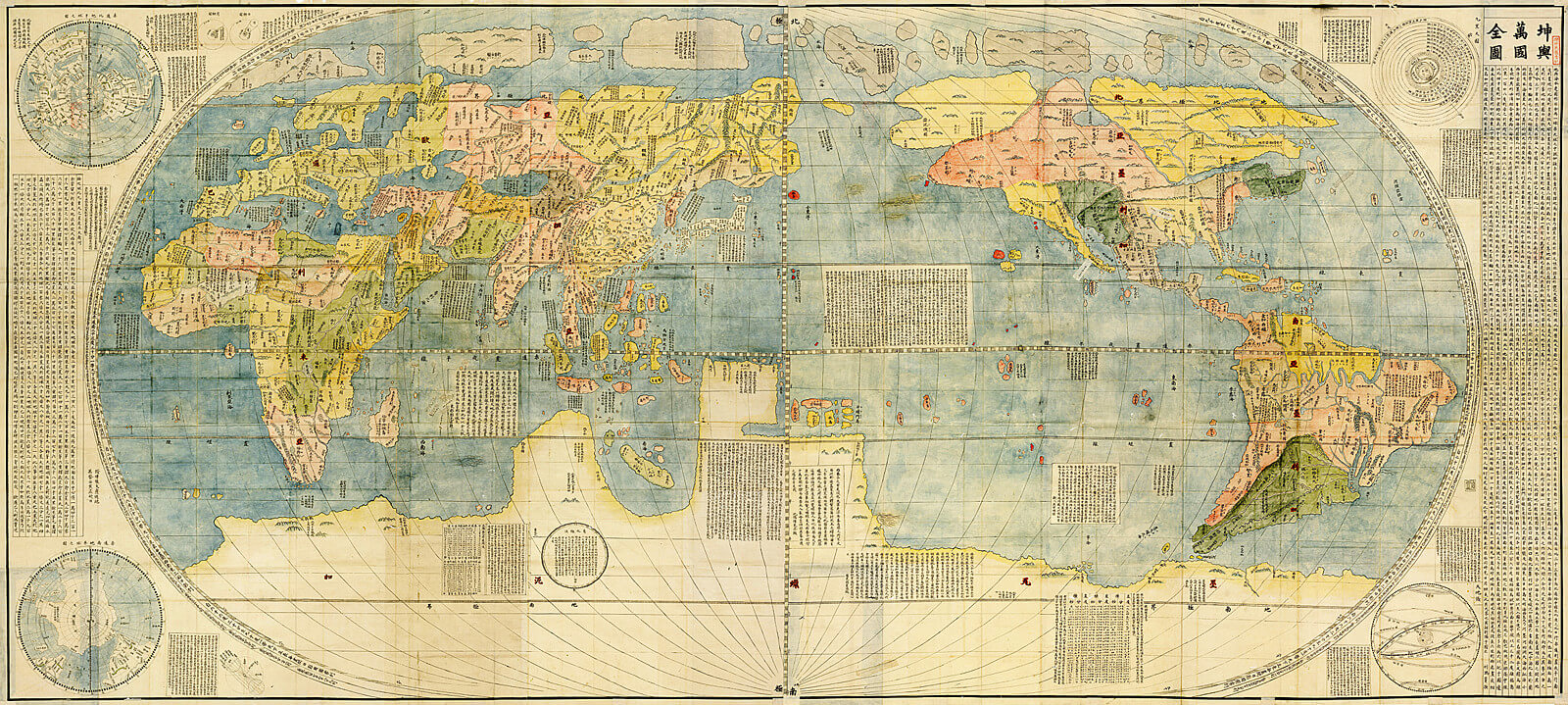Ein heißer Sommertag, Anfang Jänner in Namibia. Auf dem Hügel vor der Christuskirche in Windhoek sitzt eine Gruppe junger Afrikaner. Im Schatten einer Palme spielt einer Gitarre, ein anderer singt dazu. Es klingt nach Reggaemusik. Sie unterhalten sich mit vorbeigehenden Touristen auf Englisch. Plötzlich wechseln sie die Sprache, in ein Deutsch mit einem unverkennbaren ostdeutschen Akzent. Sie beginnen, von ihrem Leben zu erzählen und der Zeit, als sie lernten, wie „Ossis“ zu reden.
Die Geschichte der sogenannten „DDR-Kinder aus Namibia“ beginnt mit einem Massaker. Anfang der 1970er Jahre liegt die Unabhängigkeit Namibias noch in weiter Ferne. Südafrika hat das Land besetzt und unterdrückt die schwarze Bevölkerung im Sinne der Apartheid. Viele Familien fliehen nach Angola und Sambia, wo sie in Flüchtlingslagern Zuflucht finden. Im Mai 1978 fallen südafrikanische Truppen im angolanischen Flüchtlingslager von Cassinga ein. Rund 600 Menschen werden ermordet.
Die South West Africa People’s Organisation, kurz SWAPO, die marxistisch orientierte namibische Befreiungsbewegung, bittet die DDR-Regierung, namibische Kinder in Sicherheit zu bringen. Nach langen Verhandlungen kommen die ersten 80 Kinder im Dezember 1979 in Ostberlin an. Die Drei- bis Siebenjährigen sind entweder Waisen, Kinder von SWAPO-Kämpfern oder Notleidende des Krieges. Sie werden im Jagdschloss Bellin, im ostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, untergebracht. Naita, eines dieser 80 Kinder, heute eine erwachsene Frau, erinnert sich in einem Interview mit der deutschen Zeitung Tagesspiegel: „Wir sahen den ersten Schnee und dachten, es sei Zucker. Wir haben daran geleckt, aber er war eiskalt und nass.“
Bis 1989 kommen insgesamt 430 Kinder aus der krisengeschüttelten Region in die DDR. Dort sollen sie zur zukünftigen Elite Namibias ausgebildet werden. Finanziert wird der Aufenthalt aus Solidaritätsgeldern der DDR.
In Deutschland werden die Kinder zu Jungpionieren erzogen, mit Fahnenappell und Manöverübungen. In ihren Schränken, so berichtete eine ehemalige DDR-Zeitung, liegen die Kleidungsstücke Kante auf Kante, und die Bettlaken sind faltenlos zurechtgezogen. Die Woche ist straff durchorganisiert. Montags stehen Schießen und Geländeübungen auf dem Stundenplan, dienstags lernen sie kochen und Haare flechten, am Mittwoch singen sie namibische Lieder und am Donnerstag lernen sie namibische Tänze, am Freitag steht wieder Singen auf dem Programm. Samstags werden die Zimmer ordentlich aufgeräumt und am Sonntag gibt es Gruppensport. Es wird aber auch darauf geachtet, dass noch genügend Freizeit für die Kinder bleibt.
Sam Nujoma, ehemaliger Anführer der SWAPO und später erster Präsident des unabhängigen Namibias, besucht zusammen mit seiner Frau die namibischen Kinder einige Male in Deutschland. Er spricht sie mit „meine künftigen Soldaten“ an und betont immer wieder, dass sie die zukünftige Elite Namibias seien. Sie fühlen sich als etwas Besonderes mit einer vielversprechenden Zukunft als SWAPO-KämpferInnen oder DiplomatInnen. Vor diesen hohen Besuchen üben sie fleißig, wie richtige SoldatInnen zu marschieren. Zur Begrüßung führen die Kinder namibische Tänze in Röcken der namibischen Nationalfarben, rot, blau und grün, auf. Den SWAPO-Gruß beherrschen sie perfekt: Rechte Hand schräg nach oben, der Daumen berührt die Stirn, die Finger sind ausgestreckt. Dazu rufen die Kinder, wie vorher gut einstudiert, „Viva Sam Nujoma“ und lassen die SWAPO hochleben.
Während ihrer Zeit in Deutschland haben sie, wenn überhaupt, nur Briefkontakt mit ihren Eltern – und diese Briefe werden zensuriert. „Einige Kinder haben fast immer Post bekommen. Ich gehörte zu denen, die nie etwas gekriegt haben“, erzählt Matheus. „Als Sam Nujoma zu Besuch in der DDR war, habe ich ihm einen Brief für meine Mutter mitgegeben und ihn gebeten, sie ausfindig zu machen. Er hat es tatsächlich geschafft. 1987 durfte ich wegen guter schulischer Leistungen meine Mutter in Kwanza Sul in Angola besuchen“, so Matheus.
Die namibischen Kinder gehen in der DDR in öffentliche Schulen, wo sie nach einem speziellen Lehrplan unterrichtet werden. Monika Staedt, die die namibischen Kinder von 1985 bis 1988 in Geografie unterrichtet und mit ihnen im Ferienlager in Prerow an der Ostsee war, denkt gerne daran zurück. Sie sagt, es sei ihre schönste und beeindruckendste Zeit als Lehrerin gewesen. „Ich hatte immer das Gefühl, dass uns diese Kinder als ihre Ersatzeltern ansahen. Sie waren ‚meine‘ Kinder und entsprechend vertrauensvoll war unser Umgang miteinander“, so Monika Staedt.
Kurz vor der politischen Wende in Deutschland, als die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands nicht mehr das Sagen hat und die Zukunft für die namibischen DDR-Kinder ungewiss ist, werden sie zurückgeschickt. Völlig überstürzt, ohne Vorbereitung, in ein Land, das ihnen fremd geworden ist.
Im Keller des Schlosses Bellin zeigen bunte Wandmalereien Giraffen, die unter Palmen grasen. So müssen sich die Kinder ihre Heimat vorgestellt haben. Die Realität sieht anders aus. Nach ihrer Ankunft werden sie zuerst in einem der ärmsten Stadtteile Windhoeks untergebracht. Strom und Warmwasser – das gibt es nicht in Katutura. Die Jugendlichen kommen später bei ihren Familien oder bei Verwandten unter, die die meisten zum letzen Mal vor elf Jahren gesehen haben. „Ein paar Kinder wurden von irgendwelchen Leuten abgeholt. Man wusste nicht, waren das wirklich Verwandte, oder waren sie nur an den 50 Rand interessiert, die jedes Kind bekam. Ich habe geweint und wollte wieder zurück in die DDR“, erzählt Lucia, ein ehemaliges DDR-Kind.
In Namibia schienen sie nicht willkommen zu sein. „Frustrierend war, dass wir uns anfangs kaum verständigen konnten – mein Oshivambo war zu schlecht. Und dass ich für die Weißen plötzlich nicht mehr das süße Schoko-Kind war, sondern im schlimmsten Fall ein dummer Käfer“, so Oshosheni in einem Interview der Zeitschrift Geo. Einige konnten ihren Schulabschluss in einer der beiden deutschen Privatschulen in Windhoek machen. Sie waren die ersten Schwarzen, die an diesen Schulen aufgenommen wurden und haben gelernt, sich durchzusetzen.
Heute leben die meisten der ehemaligen DDR-Kinder in Namibia, einige in Deutschland. „Es gab Bestrebungen, uns als Gruppe zusammenzuhalten. Viele wollten helfen, aber wussten nicht, was wir brauchten“, sagt Patrick Hashingola. „Jetzt haben die meisten Familien, arbeiten oder studieren und haben wenig Zeit. Aber wenn wir einander treffen, dann ist das unser Ossi-Club“, erzählt Matheus. Dann sprechen sie Oshi-Deutsch, eine Mischung aus Englisch, Deutsch und ihrer eigentlichen Muttersprache Oshivambo. Oshi-Deutsch haben sie auch als Kinder in der DDR als eine Art Geheimsprache gesprochen, wenn es zum Beispiel auf dem Schulhof zu kleinen Rangeleien kam.
Die ehemaligen DDR-Kinder, die nun längst Erwachsene sind, sind in fast allen Berufsgruppen vertreten: vom Anwalt und PR-Manager über Arzthelferin, Krankenpfleger, Journalistin, Vermesser bis zum Brauer. Über diejenigen, die es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben, wird kaum berichtet, wie zum Beispiel über Georg, der an Aids gestorben ist oder Nick, der heute in den Straßen von Windhoek lebt. Bücher, Dokumentationen und Filme handeln vom Schicksal der ehemaligen DDR-Kinder, die von Medien oft als Kollektiv betrachtet werden. Es wird vergessen, dass hinter jedem Einzelnen seine eigene Geschichte steht. „Wir teilen einen wichtigen Abschnitt unserer Vergangenheit, trotzdem sind wir Individuen mit unterschiedlichen Lebenswegen“, bringt es ein ehemaliges namibisches DDR-Kind auf den Punkt. Eines haben sie noch gemeinsam: Sie sind zwischen zwei Kulturen aufgewachsen.
Matheus, der seit neun Jahren in Deutschland lebt, erzählt: „2006 war ich mit der ganzen Familie für drei Monate in Namibia, zum ersten Mal, seitdem wir im Jahr 2000 nach Deutschland ausgewandert sind. Ich habe in Namibia ein Praktikum als Webdeveloper gemacht. Am Ende hatte ich die Stelle und stand vor einer schwierigen Entscheidung. Ich habe mich entschieden, nach Berlin zurückzukehren. Am liebsten würde ich hin und her pendeln.“
„Für mich ist Heimat kein Ort, sondern einfach ein Gefühl“, sagt Andreas. „Dort wo ich mich wohlfühle, da ist auch mein Zuhause. Ich bin zwar Afrikaner, aber aufgrund meiner Vergangenheit fühle ich mich sowohl in Deutschland als auch in Namibia zu Hause.“
Ute Rammerstorfer studierte Publizistik und Ethnologie in Wien. Sie arbeitete u.a. als Redakteurin bei Radio China International in Beijing und in der Deutschen Redaktion der Namibian Broadcasting Corporation in Windhoek. Lebt derzeit als freie Journalistin in Buenos Aires.