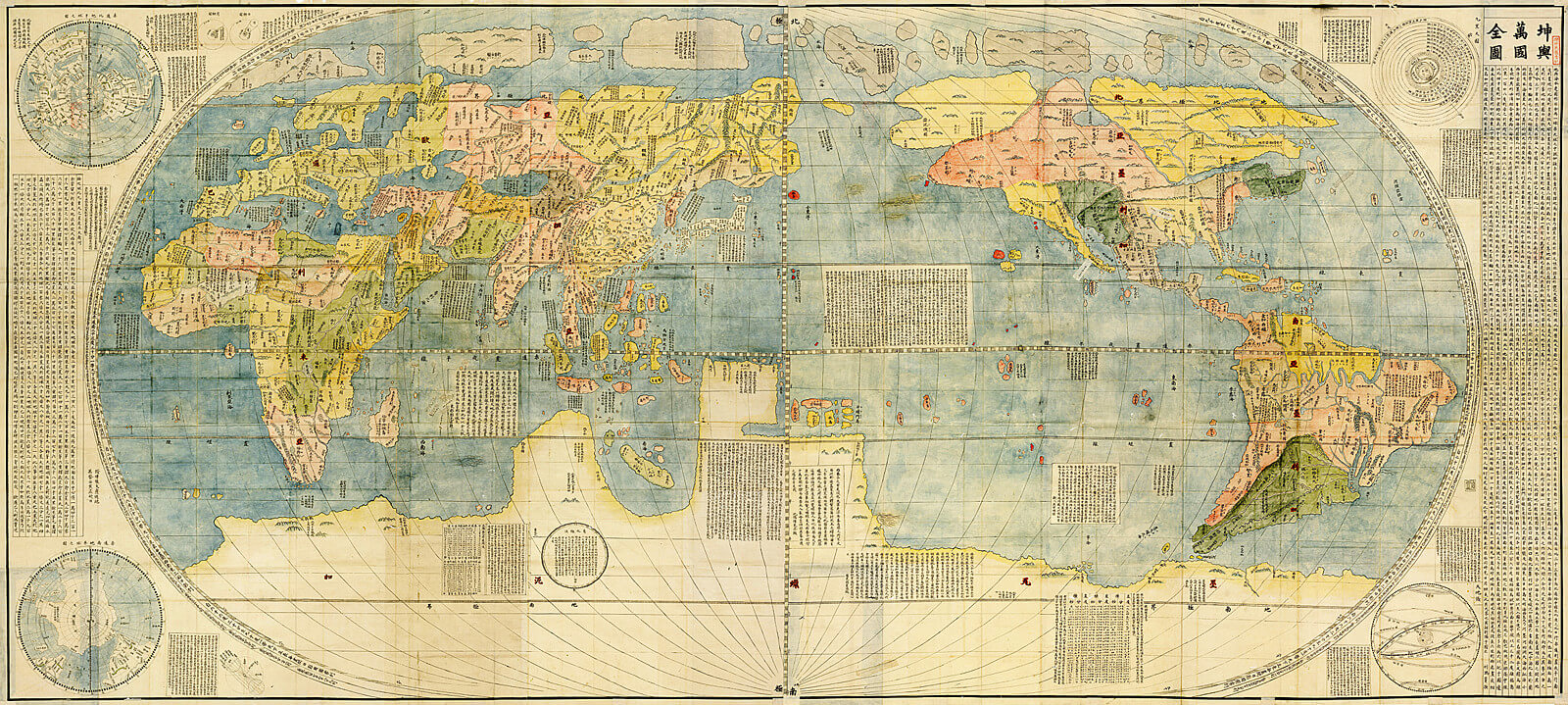Hugo Chávez hat wieder Oberwasser. Mit der Freilassung zweier prominenter Geiseln durch die kolumbianische FARC-Guerilla konnte er sich zu Recht schmücken. Auch innenpolitisch übernahm er wieder die Initiative. 2008 erklärte Chávez zum Jahr der drei R: „revisión, rectificación, reimpulso“ (Revision, Korrektur, Neuantrieb) und versprach zugleich, das Reformtempo zu drosseln.
Anfang Dezember hatte der Staatschef seine erste Abstimmungsniederlage in neun Jahren hinnehmen müssen: Die VenezolanerInnen lehnten seinen Vorschlag für eine „sozialistische“ Verfassung mit knapper Mehrheit ab. Während die Nein-Stimmen ungefähr dem Ergebnis des Oppositionskandidaten Manuel Rosales bei der Präsidentenwahl im Dezember 2006 entsprachen, bekam der Reformvorschlag drei Millionen Stimmen weniger als Hugo Chávez damals – und das bei einer anhaltend hohen Popularität des Staatschefs.
„Entscheidend war das Stimmverhalten innerhalb des Chavismo“, meint denn auch der linke Soziologe Edgardo Lander. „Das Ergebnis hat den Mythos vom messianischen Führer begraben, dem das Volk blind und bedingungslos folgt. Es hat gezeigt, dass es eine echte Politisierung, einen Bewusstwerdungsprozess gibt.“
„Die Leute haben ihr Unbehagen artikuliert, ohne den Fortbestand der Regierung oder ihres Projekts des sozialen Wandels zu gefährden“, sagt Lander. Für das „wachsende Unbehagen“ bei vielen Chávez-WählerInnen nennt er eine ganze Reihe von Gründen: das Gefühl einer großen Unsicherheit bei gleichzeitiger Untätigkeit der Regierung – in den letzten neun Jahren wurden 90.000 VenezolanerInnen ermordet. Die grassierende Korruption bei gleichzeitiger Ineffizienz in der öffentlichen Verwaltung. Schließlich die Art und Weise, wie die Verfassungsreform „in einer geschlossenen Kommission, ohne Debatte“ ausgearbeitet wurde: „Die Leute haben sich ausgeschlossen gefühlt.“ Edgar Pérez sieht das ähnlich. „Im Vergleich zu früher ist Chávez viel weniger zugänglich“, sagt der Aktivist aus dem Stadtteil La Vega. „Seine Funktionäre haben ihn entführt.“ Edgardo Lander: „Es ist ein Warnschuss für die Regierung. Entweder sie lässt eine breite Debatte und selbstkritische Überlegungen zu – oder sie verschärft ihre bisherige Gangart. Das allerdings wäre der Anfang vom Ende.“
Die Menschenschlange erstreckt sich entlang der Straße über mehrere Häuserblocks. Im Süden von Caracas, unweit der Metrostation von El Valle, organisiert das „Ministerium der Volksmacht für die Ernährung“ wieder einmal einen seiner „Megamärkte“. Lilian Gómez nimmt es gelassen: „Heute gibt es Milchpulver und Schinken, und noch dazu billig“, meint die 49-jährige Lehrerin. Sie ist mit dem Bus aus einem Viertel weiter südlich gekommen. Der dortige Mercal, wie die venezolanischen Supermärkte mit subventionierten Lebensmitteln heißen, ist seit einem Raubüberfall vor ein paar Wochen geschlossen. Dazwischen liegt noch einer, doch dort sind die Regale gähnend leer.
Anfang 2008 zieht der scheidende Minister Rafael Oropeza Bilanz: Wie schon im Vorjahr habe der Staat 2007 gut 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel verteilt. Während die Nachfrage um fast ein Fünftel stieg, lag der Zuwachs bei der Produktion nur bei neun Prozent. Bei den Produkten mit den größten Engpässen, Zucker und Milchpulver, wurde ein Drittel bzw. die Hälfte über die Behörden verkauft, sagt der hohe Funktionär. Welchen Rat hat er für seinen Nachfolger? „Das ist ganz einfach: Es muss mehr produziert werden.“
Doch dem stehen die vor fünf Jahren eingeführten Festpreise für viele Lebensmittel entgegen, durch die eigentlich die Inflation gebremst werden sollte. Deswegen lohnt es sich schlichtweg nicht mehr, manche Güter herzustellen. Zudem beschränken private Unternehmer auch in der Landwirtschaft ihre Investitionen auf ein Minimum – wegen ungewisser Zukunftsaussichten.
Genossenschaften oder Staatsbetriebe können dieses Defizit nicht wettmachen. Die 2007 gegründeten „sozialistischen“ Betriebe, die dem Landwirtschaftsministerium zugeordnet sind, sind gerade für 1,5 Prozent der Gesamtproduktion verantwortlich. Insgesamt liegt die Staatsquote bei der Lebensmittelversorgung bei 20 Prozent, doch 70 Prozent davon werden importiert. Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern, räumt Landwirtschaftsminister Elías Jaua ein: „Venezuela hat genügend Devisen.“
„Die Regierung hat viele Ölmillionen in die ‚endogene Entwicklung‘ gesteckt, aber mit den Importen kann diese Produktion einfach nicht konkurrieren“, sagt Edgardo Lander.
Drei Auto-Stunden östlich von Caracas, in der üppig grünen Karibikregion Barlovento, wird die Spannung zwischen paternalistischer Staatsfixierung und Selbstorganisation an der Basis bereits seit Jahren gelebt. In Zusammenarbeit mit Behörden entwickelten genossenschaftlich organisierte Kakaobäuerinnen und -bauern über Jahre hinweg das Projekt einer Kakaofabrik, die Chávez im Oktober 2006 einweihte. Wenig später unterzeichnete er ein Dekret, das den organisierten Bauern und Bäuerinnen 49 Prozent und dem Staat 51 Prozent der Anteile an der „sozialistischen Aktiengesellschaft“ zuwies.
Nach einer monatelangen Pattsituation, in der die Mitglieder der Kooperative den Geschäftsführer stellten und der Staat den Fabriksdirektor, ordnete der Präsident im April 2007 die völlige Verstaatlichung an. Doch die GenossenschafterInnen wehrten sich und erwirkten im Oktober einen Gerichtsentscheid, der ihre Rechte wiederherstellt. Ihr Sprecher Juan Martínez fordert: „Die Fabrik muss wieder als selbst verwaltetes Projekt den Produzenten überlassen werden, und zwar über die organisierten Kommunen.“
Die Staatsbürokraten allerdings wissen den örtlichen Bürgermeister und den Landwirtschaftsminister Jaua hinter sich und wollen das Feld nicht räumen. Kakaobutter und -pulver werden schon seit Monaten nicht mehr produziert. An eine wirkliche Wende glaubt Martínez nicht mehr: „Im Konflikt hat sich gezeigt, dass jeder sich selbst der Nächste ist“, sagt er enttäuscht. „Für einen echten Sozialismus sind nur die Wenigsten.“ Dass Chávez´ Verfassungsvorschlag im Barlovento deutlich abgelehnt wurde, liege auch an den unbeliebten Parteigenossen des Präsidenten, die sich im Staatsapparat festgesetzt haben.
Doch Juan Martínez sieht auch Anlass zu neuer Hoffnung für den „Prozess“, wie die meisten Chavistas die „bolivarische Revolution“ nüchtern nennen. „Nach der Niederlage wird so intensiv und breit über Gesellschaftsmodelle diskutiert wie noch nie“, sagt der 48-jährige Aktivist. „Immer mehr trauen sich, die Bürokraten und die Korrupten offen zu kritisieren. Das ist keine vorübergehende Mode, das bleibt“, ist er überzeugt.
Und der Präsident? Offensichtlich hat er eingesehen, dass er sich 2007 gehörig vergaloppiert hatte. „Wir haben zu viele Fronten aufgemacht“, bekannte er in der ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr. In fast täglichen Reden, sei es in seiner TV-Show „Aló Presidente“, sei es vor der Nationalversammlung oder auf dem Gründungsparteitag der „Sozialistischen Einheitspartei Venezuelas“ (PSUV), entwickelte Chávez im vergangenen Jänner die Marschroute für das Jahr 2008.
Dabei schlug er versöhnliche Töne an und betonte die Bedeutung der Mittelschicht für sein „bolivarisches“ Projekt. Das Reformtempo will er verringern: „Ich bin schneller vorangegangen, als das Kollektiv konnte, das war einer meiner Fehler.“ Und erstmals seit seiner Amtsübernahme 1999 schien er das Problem der Kriminalität ernst zu nehmen und kündigte Aktionsprogramme an.
Seinen egozentrischen Regierungsstil dürfte Chávez allerdings beibehalten, das demonstrierte er in der 300. Sendung von „Aló Presidente“ Mitte Jänner. Nachdem aus dem Publikum der schlechte Zustand der Landstraßen in der Agrarprovinz Guárico und die Untätigkeit der Behörden beklagt wurden, kündigte er unter großem Beifall den Stopp der Asphaltexporte und die Abschaffung von Mautstellen an.
Bei der Kabinettsumbildung zu Jahresbeginn gab es wenige neue Gesichter, viele Minister wechselten nur das Ressort. Ob die Appelle des Präsidenten an die „Disziplin“ und die „Effizienz“ seiner Mitarbeiter mehr fruchten werden als bisher, darf bezweifelt werden. Als konkreteste Maßnahme gegen die Korruption schlug er Überraschungsbesuche bei Ministern vor.
Ein Kernpunkt seiner gescheiterten Verfassungsreform, nämlich die Möglichkeit zur unbegrenzten Wiederwahl, lässt Chávez immer noch nicht ruhen – auch wenn er eine neue „Volks“-Initiative für ein weiteres Verfassungsreferendum zumindest für dieses Jahr ausschließt. „Ich betrachte mich nicht als unverzichtbar“, behauptete er kürzlich in „Aló Presidente“, fügte dann aber hinzu: „Wir brauchen Kontinuität in der Revolutionsführung über das Jahr 2012 hinaus.“