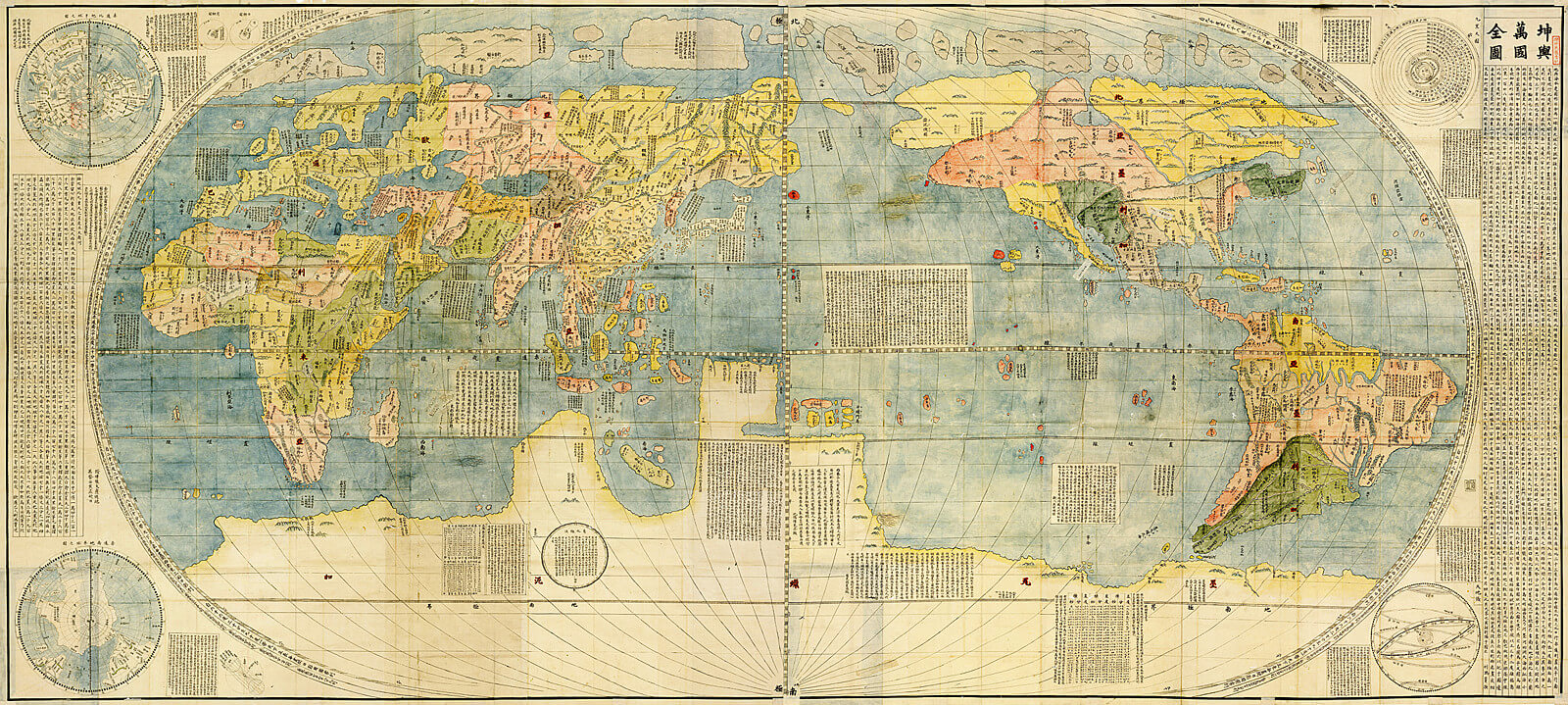
Zahlreiche österreichische Initiativen und Organisationen sind in Sri Lanka am Wiederaufbau nach dem Tsunami beteiligt. Südwind-Mitarbeiter Ralf Leonhard, der im vergangenen Dezember unmittelbar nach der Flutwelle Sri Lanka bereiste, hat sich ein Jahr nach der Katastrophe erneut zu einem Lokalaugenschein in den Inselstaat begeben.
Auch jenseits der Küstenstraße stehen die Ruinen der Häuser, die nicht komplett weggespült wurden, als wäre die Katastrophe vor wenigen Tagen passiert. Doch dazwischen wurden Zelte oder provisorische Massenlager errichtet, wo die Obdachlosen warten, bis sie ein neues Heim bekommen. Obwohl vor allem im Süden heftig gebaut wird, kann man jetzt schon sagen, dass bis zum Jahrestag nur ein kleiner Prozentsatz jener Familien, die alles verloren haben, ein festes Dach über dem Kopf haben wird. Folgt man der Küstenstraße von der Hauptstadt Colombo Richtung Galle im Südwesten, sieht man in fast jedem Ort Schilder, die die Aufbauarbeit österreichischer Hilfswerke anzeigen: der Samariterbund, das Hilfswerk Austria, die Salesianer Don Bosco, aber auch Austrian Airlines, Kurier und viele kleine Initiativen sind hier vertreten.
Im kleinen Dorf Paraliya, rund 30 Kilometer vor der ehemaligen niederländischen Hafenstadt Galle, ist der Fischer S. H. Karunadasha mit seiner Familie bereits in sein Haus eingezogen. Wie fast alle Tamilen und die meisten Singhalesen gibt er den Vornamen nur mit dem Initial an. „Gift of the Austrian People“ steht in Englisch und Singhalesisch auf einer weißen, weithin sichtbaren Tafel neben der Tür. Dazu das Logo von Don Bosco und der Austrian Development Agency (ADA). Die meisten Organisationen schmücken die von ihnen finanzierten Häuser mit derartigen Plaketten. Die ADA verpflichtet jeden Vertragspartner, dem sie Kofinanzierung zukommen lässt, sogar vertraglich zur Anbringung eines solchen Schildes. Manche Geldgeber begnügen sich aber auch damit, in einer Siedlung mit einer einzigen Tafel auf ihre Spende hinzuweisen.
Noch größer ist allerdings die Tafel, auf der Handels- und Verbraucherschutzminister Jeyaraj Fernandopulle gerühmt wird, der die Finanzierung dorthin kanalisiert hat. Ein gerahmtes Portrait des Ministers wird als Grundausstattung für die Häuser mitgeliefert.
Herr Karunadasha und seine 21jährige Tochter sind damit beschäftigt, auf einem metallenen Spinnrad ein Seil aus Kokosbast zu drehen. Die Ehefrau steht im nahe gelegenen Hikkaduwa in sengender Hitze Schlange vor der Bankfiliale, um die monatliche Tsunami-Hilfe abzuholen. Die Häuser sind alle nach einem Einheitsmodell gestaltet, das die Regierung vorgegeben hat: auf 50 m2 ein Wohnraum, zwei Schlafzimmer, Küche. In der Regel beteiligt sich die Familie an den Hilfsarbeiten: Aushub, Zement mischen oder Ziegelherstellung. Das macht die Arbeit etwas billiger und vermittelt den Menschen das Gefühl, nicht nur Geschenkempfänger zu sein, sondern auch selbst etwas geleistet zu haben. Viele leben in einer behelfsmäßigen Hütte neben dem noch unfertigen Neubau. Es sind die Glücklichen, die ein Stück Land ihr Eigen nennen, wo gebaut werden konnte. Aber eine große Zahl von Obdachlosen, die noch in tristen, finsteren Zeltverschlägen hausen, haben noch keine Aussicht auf ein neues Eigenheim. Manche von ihnen betteln TouristInnen oder die zahlreichen Delegationen europäischer Nichtregierungsorganisationen (NGOs) an. Sie lebten direkt am Strand, wo nach Verfügung der Regierung nicht mehr gebaut werden darf.
Herr L.U. Sriyananda zeigt auf seine Hütte aus Treibholz und Pappkartons in Telwatta, wo die sechsköpfige Familie auf engstem Raum haust. Noch niemand habe ihm ein Haus hingestellt, klagt er. Weiter landeinwärts entstünde eine Siedlung. Aber da will er nicht wohnen. Als Fischer müsse er nahe dem Meer leben. Eine Frau, die mit zwei Halbwaisen hinter einer Plane mit dem Aufdruck des UNO-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR hervorblickt, hat überhaupt noch keine Perspektive. „Children hungry, no money“, jammert sie. Ihr Haus stand direkt am Strand, wo eigentlich gar nicht gebaut werden durfte und niemand Eigentum erwerben kann. Eine Frau von der Bezirksbehörde, die mit riesigen Formblättern ausgerüstet verschiedene Grundstücke inspiziert, weiß auch nicht, was mit den Leuten passieren soll, für die noch kein Bauprojekt geplant ist. „Die werden wohl noch lange provisorisch wohnen“, fürchtet Giovanna Fassio vom Volontariato Italiano di Sviluppo (VIS), einem italienischen Hilfswerk der Salesianer Don Bosco.
Nach dem Tsunami verhängte die Regierung ein generelles Bauverbot für eine Sicherheitszone, die – je nach Topographie – 200 oder 300 Meter betragen sollte. Ausnahmen wurden nur für Hotels und Tourismusanlagen gemacht. Doch diese Regel warf eine Unmenge von Problemen auf: Eigentumsfragen waren zu klären, Bauland für neue Siedlungen bereitzustellen. Und was war mit den Häusern innerhalb der Zone, die dem Tsunami standgehalten hatten oder repariert werden konnten? Die Bürokratie war dem nicht gewachsen, viele Projekte wurden dadurch endlos hinausgezögert. Als der Oppositionskandidat Ranil Wickremesinghe im Wahlkampf versprach, die Pufferzone aufzuheben, zog der Regierungskandidat und Premierminister Mahinda Rajapakse schnell nach. Es blieb allerdings bei der Ankündigung. Generelle Verordnung wurde keine erlassen. Deswegen suchten die Bezirksbehörden lokale Lösungen. Und heute weiß niemand, ob schließlich 100 Meter, 65 oder gar nur 25 Meter bleiben werden. Bis zu den Wahlen vom 17. November wollte kein Bauunternehmer Kostenvoranschläge erstellen oder Aufträge annehmen.
Schwieriger Norden und Osten: Das VIS baut an der Nordostküste ein Dorf namens Kalampathay wieder auf. Rund 50 Kilometer oder zwei Stunden Autofahrt von der Hafenstadt Trincomalee über eine Straße, die während der Monsunzeit häufig unpassierbar ist, liegt die tamilische Siedlung weit genug vom Meer entfernt, sodass die Pufferzone keine Rolle spielt. Deswegen sind die Arbeiten schon relativ weit fortgeschritten. Die EinwohnerInnen wurden dort vor 20 Jahren vertrieben oder flohen nach einem Massaker der Regierungsarmee an einer Gruppe von Jugendlichen, denen sie vorwarf, mit der Befreiungsbewegung der Tiger von Tamil Eelam (LTTE) zu kooperieren. V. Parvathy war damals noch eine junge Frau. Mit Schaudern erninnert sie sich an die Zeit, als in dieser Gegend Gefechte und Säuberungsaktionen der Militärs an der Tagesordnung waren. Seit Februar 2002 herrscht zwar Waffenstillstand, doch die Wunden des 20-jährigen Bürgerkrieges müssen erst vernarben. Längs der Straße sind Bänder gespannt, und grellrote Schilder warnen vor den Minen, die hier noch zu Tausenden vergraben sind und die Landwirtschaft nur in geringem Umfang möglich machen. Ältere Ziegelhäuser sind praktisch keine mehr zu sehen. Nur rauchgeschwärzte Ruinen, in deren Wänden noch die Einschusslöcher von erbitterten Schlachten zeugen, erinnern daran, dass dieses Gebiet einmal bewohnt war. Noch immer sitzen die Militärs in ihren Stellungen hinter Wällen aus grünen Sandsäcken und halten alle paar Kilometer an ihren Kontrollpunkten jedes Fahrzeug an.
Am Rande von Trincomalee baut das Burgenland ein Dorf. Im Büro der buddhistischen Organisation Sarvodaya wird eine goldene Fahne mit dem roten Adler entrollt. Zwei dicke Photoalben dokumentieren den Besuch pannonischer Delegationen. Die Siedlung von hundert Häusern, mit deren Errichtung Sarvodaya betraut ist, besteht erst auf dem Papier. Der lokale Koordinator, V. Jeevaraj, ist erleichtert, dass die amtliche Vermessung endlich abgeschlossen ist. Das war gar nicht einfach, denn das Modelldorf Samudragama besteht aus mehreren Teilen, wo neben dem Burgenland auch das japanische Rote Kreuz, Care und das Kinderschiff aus Deutschland bauen. Deren Bezirke sind aber teilweise noch nicht einmal gerodet und es kostete einige Überzeugungsarbeit, bis die Behörden die Teilvermessung genehmigten.
Das Burgendland-Dorf ist eines von drei Vorhaben, die vom Institute for Integrative Conflict Transformation (IICP) in Wien als Friedensprojekt konzipiert sind. Je ein buddhistisches, ein tamilisches und ein muslimisches Dorf werden in den den drei gemischt-ethnischen Ostküsten-Distrikten Trincomalee, Batticaloa und Ampara errichtet. Zwei finanziert die Kurier-Spendenaktion. Es entstehen nicht nur Häuser, sondern auch Kindergärten und ein großes Friedenszentrum, das für Begegnungen zwischen den Bevölkerungsgruppen dienen soll. Damit wird der Tsunami-Wiederaufbau dazu genützt, die verfeindeten Gruppen einander anzunähern. Christopher Temt, der in Sri Lanka als Projektmediator für das IICP fungiert, freut sich, dass es gelungen ist, für diese Siedlungen vom staatlich vorgegebenen Einheitsmodell abzugehen. Die Häuser sind zwar nicht größer, aber sie werden tragende Säulen haben, die es in Zukunft erlauben, Wände abzutragen, Fenster oder Türen einzubauen und Erweiterungen vorzunehmen, ohne dass der Bau einstürzt. Geschlossene Duschen in jedem Haus sollen vor allem die Intimsphäre der Frauen schützen. Jede Familie kann in Absprache mit dem Architekten individuell planen. Das erlaubt den Hindus auch, Türen und Grundriss so einzurichten, dass die Hausgötter günstig gestimmt werden. Die Zusammenarbeit mit lokalen Basisorganisationen, echten Graswurzelbewegungen, erleichtert es, Günstlinge der Regierung, die vom Tsunami gar nicht betroffen wurden, auf den von der Bezirksverwaltung präsentierten Listen schnell zu entdecken und zu entfernen.
Wenn der Aufbau im Osten schon schwierig ist, so ist er im Norden kaum noch angelaufen. Im Vanni, dem Gebiet, das der Rebellenorganisation LTTE für die Zeit der Waffenruhe zur Selbstverwaltung überlassen wurde, kommt von der internationalen Hilfe wenig und von der staatlichen Unterstützung nichts an. „Keinen Cent“ habe die Regierung ins völlig zerstörte Fischerdorf Mullaitivu geschickt, sagt Schwester Rajes vom Orden des Guten Hirten. Dabei senkt sie ihre Stimme, als spreche sie etwas Verbotenes aus. Über ihre Vermittlung hat Jugend eine Welt, das österreichische Don-Bosco-Hilfswerk, 30 Boote für die um ihre Existenz gebrachten Fischer gestiftet. Dabei wacht die Armee peinlich genau darüber, dass keiner der Außenbordmotoren mehr als 15 PS Leistung bringt. Sie könnten ja von den Sea Tigers, der vom Tsunami schwer getroffenen Kriegsmarine der LTTE, requiriert werden. Allerdings hatten deren Boote 250 PS.
Vergessene Kriegsopfer: Eine nüchterne Bilanz der Tsunami-Katastrophe in Sri Lanka räumt mit einigen gerne gepflegten Mythen auf. Die alarmierende Nachricht, Tausende Minen seien verstreut oder verschoben worden, war durch die Überflutung des Arsenals in einem einzelnen Armeeposten im Nordosten ausgelöst worden. Von Opfern ist nichts bekannt. Dennoch ließ das Österreichische Bundesheer seine Truppe, die im Süden für sauberes Trinkwasser sorgte, sechs Wochen lang von zwei Sprengstoffexperten beschützen. Ein anderer Mythos betrifft die Anzahl der Waisenkinder. Nach Berichten über Zigtausende Tsunami-Waisen kam eine Welle von Adoptionsangeboten aus Europa und den USA. Die nationale Kinderschutzbehörde spricht von weniger als tausend Vollwaisen, von denen die meisten in der erweiterten Familie untergebracht werden konnten. Die restlichen wurden auf Waisenhäuser in ihrer Region verteilt. Ein Pater, dessen Name hier nicht genannt sein soll, fürchtet deswegen Probleme mit den Spendern, die einen Zubau finanzieren. Der war schon lange notwendig geworden, um die Kriegswaisen unterzubringen. Mit dem Tsunami gab es plötzlich Geld. Doch kurz vor Fertigstellung des Gebäudes halten sich kaum noch Flutopfer im Waisenzentrum auf.
Hunderttausende von Vertriebenen, die der Bürgerkrieg über das Land verstreut hat, leben zum Teil schon 15 Jahre lang in Massenunterkünften. Für sie hat es weit weniger Solidarität gegeben als für die Obdachlosen, die der Tsunami hinterließ. Aus den Schleusen des internationalen Mitgefühls ergoss sich soviel Geld, dass auch die Profiteure mit Scheinprojekten Kasse machen konnten. Sri Lanka soll bereits doppelt so viele Fischerboote haben wie vor dem Tsunami – allerdings ungleich verteilt. Die Nachfrage nach Baumaterial und Facharbeitern hat Preise für Zement und Gehaltsforderungen derart in die Höhe schnellen lassen, dass die Inflation nächstes Jahr wohl alle Bereiche erfassen wird. Mit einem blauen Auge davongekommen sind die Betreiber von Luxushotels, aus denen die TouristInnen noch fernbleiben, die sich aber mit gutbezahlten ExpertInnen von Legionen von Hilfswerken füllen. Es wäre zu wünschen, dass man sich jetzt auch der Kriegsopfer besinnt und die internationale Präsenz dazu beiträgt, ein Wiederaufflammen des Konflikts, der noch der endgültigen Lösung harrt, zu verhindern.
Ralf Leonhard ist freier Mitarbeiter des Südwind-Magazins und hielt sich im Jänner und November d. J. als Journalist in Sri Lanka auf.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.


