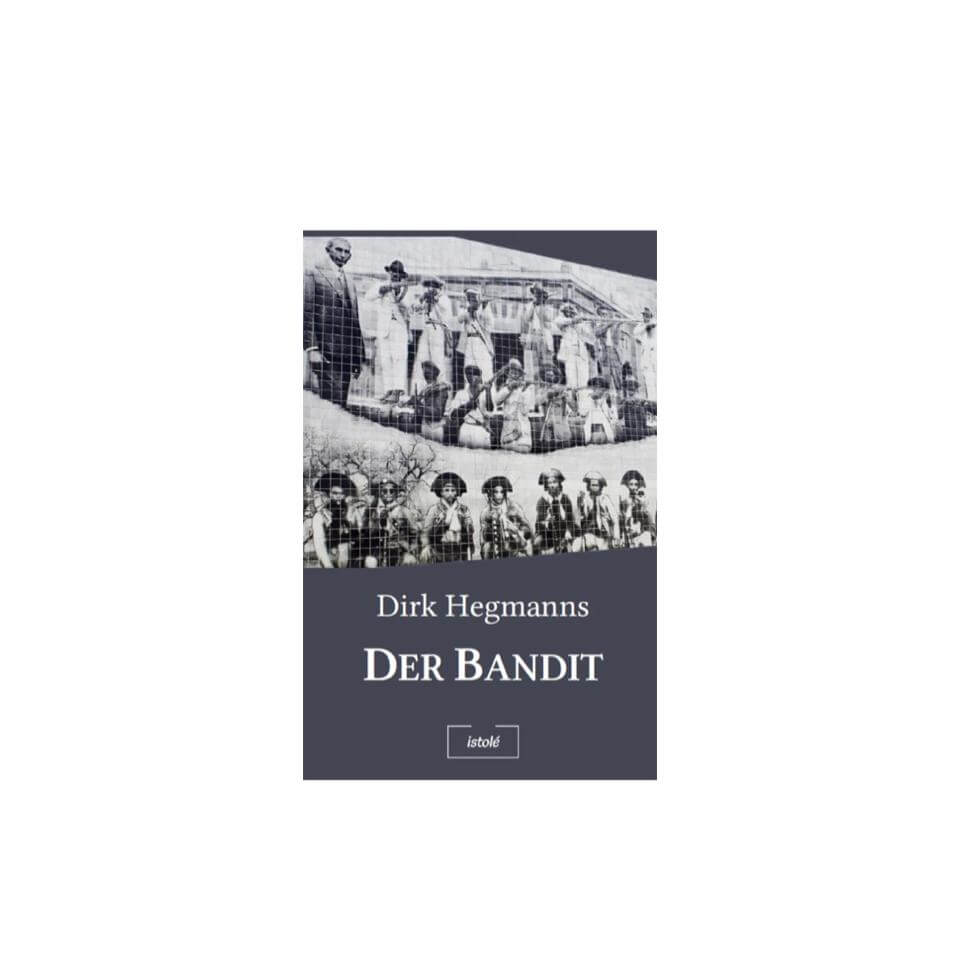Tunesien wählt demnächst ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Vieles hat sich seit der Revolution 2011 im Land gut entwickelt. Doch die Herausforderungen sind nach wie vor gewaltig.
An den Mauern sieht man noch Farbreste, die Umrisse von durchnummerierten Rechtecken lassen sich erahnen. Hier durften für die Wahlen zur Verfassungsversammlung im Herbst 2011 die Parteien ihre Plakate aufhängen. Feinsäuberlich durchnummeriert und reglementiert, so dass auch ja keiner mehr Platz als der andere hat. Fast auf den Tag genau drei Jahre später werden die Rechtecke wieder genutzt: fast genau so viele Parteien und unabhängige Listen treten dieses Mal an. Ansonsten hat sich seitdem in Tunesien allerdings vieles verändert – ob zum Guten oder zum Schlechten, darüber sind sich die Menschen in Tunesien selten einig.
Am 26. Oktober wählt Tunesien ein neues Parlament. Knapp einen Monat später folgen die Präsidentschaftswahlen. Es ist eine richtungweisende Zeit für das Land, in dem der so genannte Arabische Frühling seinen Anfang nahm.
Bis heute gilt Tunesien für viele als Erfolgsgeschichte: Während Staaten wie Libyen oder Ägypten nicht zur Ruhe kommen und der Syrien-Konflikt zunehmend eine internationale Herausforderung wird, gab sich Tunesien eine von vielen gelobte neue Verfassung.
Der Enthusiasmus, der bei den ersten freien Wahlen 2011 in der Luft lag, war bei der Verabschiedung der Verfassung Anfang 2014 noch einmal kurz spürbar.
Doch die Herausforderungen sind groß: Vor allem gilt es, das neue Grundgesetz in die Praxis umzusetzen. Stärkung der Regionen steht drinnen, mehr finanzielle Unabhängigkeit für die einzelnen Bezirke, weg vom Zentralismus, den Tunesien von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich geerbt hat. Was auf dem Papier so einfach klingt, ist in der Praxis schwierig.
Mohamed* schiebt die Ärmel hoch, zündet sich noch eine Zigarette an. „Hier in der Region sind wir uns alle einig, aber in Tunis hören sie uns ja nicht zu“, poltert der kräftige Mittvierziger, der in der Stadtverwaltung arbeitet. Hier, das ist in Tozeur, einer Kleinstadt in der Wüste, nahe der algerischen Grenze und der Drehort von „Star Wars“-Filmen.
Seit 2011 bleiben hier die TouristInnen weg und die Oase trocknet immer mehr aus. Denn die Swimmingpools müssen trotzdem gefüllt, die Golfplätze gewässert werden. Eine internationale Kette will hier einen großen Supermarkt bauen. Ein Platz ist schon gefunden, doch dafür müsste ein kleiner Teil der Brachfläche neben dem maroden Stadion umgewidmet werden. „Wenn die hier bauen, könnten wir die Tribüne renovieren und die Umkleiden sanieren. Das kommt doch allen zugute“, sagt Mohamed. Der regionale Sportausschuss hat sich überzeugen lassen, doch das Ministerium in Tunis blockt ab.
Internationale Investoren anzulocken passt dabei eigentlich hervorragend ins Konzept, das die aktuelle Regierung verfolgt. 2013 kam es in Tunesien zur politischen Krise, nachdem zwei wichtige Oppositionspolitiker ermordet wurden, vermutlich von islamistischen Extremisten. Daraufhin hatte eine Regierung aus parteiunabhängigen Expertinnen und Experten das Ruder übernommen. Doch die wirtschaftlichen Aussichten sind düster: Das Wachstum war mit 2,1 Prozent im ersten Halbjahr noch geringer als 2013, der Haushalt musste nachgebessert werden, das Geld für wichtige Reformen und Infrastruktur fehlt an allen Ecken und Enden.
Um sich unabhängiger zu machen von Krediten des Internationalen Währungsfonds, Europas und der Golfstaaten und um die eigene Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, sucht Tunesien jetzt nach direkter Finanzierung von Infrastrukturprojekten. „Invest in Tunisia – Start up democracy“ lautete der Titel einer Konferenz Anfang September, bei der sich Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen wie Siemens, Total und Google sowie der Europäischen Entwicklungsbank genauso wie hochrangige Politikerinnen und Politiker aus Europa, den USA und den Golfstaaten tummelten.
Tunesiens Premierminister Mehdi Jomaâ warb dafür, nach dem politischen nun auch den wirtschaftlichen Übergang zu unterstützen: „Heute investieren, um sich die Dividende von morgen zu sichern!“ Das Wort Geberkonferenz vermied der Regierungschef. Statt zu „betteln“ wolle man das Vertrauen der verunsicherten Investoren zurückgewinnen, gegen den Schwarzhandel vorgehen, Steuergerechtigkeit schaffen und Arbeitslosigkeit bekämpfen. Aber auch das Sozialsystem will Tunesien neu aufsetzen – große Reformen, die die Übergangsregierung noch vor Ende ihrer Amtszeit auf den Weg bringen will.
Insgesamt 22 Projekte mit einem Volumen von mehr als fünf Milliarden Euro wurden vorgestellt: neben dem Bau von Krankenhäusern, Wasserentsalzungsanlagen und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollen auch das Stromnetz modernisiert und das ganze Land mit Highspeed-Internet ausgestattet werden. Und Jomaâs Werben stieß während der Konferenz auf Wohlwollen: Vor allem dass Tunesien zum ersten Mal konkrete Projekte auf den Tisch legte, die gleichzeitig das Potenzial haben, die angespannte soziale Lage etwas zu beruhigen, wurde von vielen positiv bewertet.
Unter den interessierten Unternehmen ist Alstom. Der französische Konzern baute in Tunis bereits die S-Bahn aus. Wie die britische Zeitung Financial Times berichtete, hat Alstom Verfahren wegen Schmiergeldzahlungen am Hals, unter anderem auch in Tunesien. Doch das interessierte auf der Konferenz niemanden. Hédi Larbi, Minister für Raumplanung und nachhaltige Entwicklung, war hocherfreut, dass die Investoren und Institutionen an den vorgestellten Projekten Interesse zeigten.
Tunesien braucht wirtschaftliche Erfolge, denn der Frust wächst. Viele hatten gehofft, dass sich ihre Situation nach dem politischen Umbruch zügig verbessern würde. Doch mehr als drei Jahre später ist oft das Gegenteil der Fall: Die Wirtschaft ist eingebrochen, zudem fühlen sich die Menschen weniger sicher. Durchlässige Grenzen zu Libyen und Algerien haben aus Tunesien einen Umschlagplatz für Waffen gemacht, auf dem Chaambi-Bergmassiv im Westen nahe der algerischen Grenze führen Militär und bewaffnete extremistische Gruppen seit mehr als einem Jahr zähe Auseinandersetzungen.
Jomaâ fordert Geduld: „Eine Revolution destabilisiert erst einmal, und es braucht Zeit, ein neues System aufzubauen.“ Doch die Tunesierinnen und Tunesier wenden sich immer mehr von der Politik ab – oder gar dem alten System wieder zu. In einer kleinen Bar in Tunis diskutieren Studierende über die bevorstehenden Wahlen. „Ich habe mich registrieren lassen, aber für wen ich stimmen werde? Keine Ahnung.“ Ahmed zuckt mit den Schultern. Es sei ein Fehler gewesen, die RCD, die ehemalige Regierungspartei Ben Alis, aufzulösen. „Die wussten wenigstens, wie man ein Land führt. Ich würde die sofort wählen“, setzt er an, bevor ihn sein Tischnachbar Bassem scharf anfährt. Dafür seien sie doch damals nicht auf die Straße gegangen.
Auch Bassem weiß noch nicht, wem er seine Stimme geben wird. Die Liste derer, die er von vornherein ausschließt, ist jedoch lang: Ganz oben stehen die Ennahda, die islamistische Partei, die aus den Wahlen zur Verfassungsversammlung 2011 als stärkste Kraft hervorgegangen war, und Nidā'Tūnis („Ruf Tunesiens“) – eine säkulare, konservativ-bürgerliche Partei. Sie war ursprünglich als Gegengewicht zu Ennahdha gegründet worden, doch inzwischen mehren sich in ihren Reihen die AnhängerInnen des alten Regimes. Selbst Mohamed Ghariani, letzter Generalsekretär von Ben Alis RCD, ist inzwischen Mitglied. „Am Ende werden die beiden noch aus Machtgier koalieren“, spekuliert Bassem. Ihn würde gar nichts mehr wundern, Politikern könne man sowieso nicht trauen.
Seit Diktator Ben Ali aus Tunesien geflohen ist, wird an jeder Straßenecke über Politik diskutiert – früher wäre das undenkbar gewesen. Aber die Situation ist auch unübersichtlich: Rund 1.300 Parteien, Bündnisse und unabhängige Listen treten in den verschiedenen Wahlbezirken zu den Parlamentswahlen an, fast genauso viele wie 2011. Die Hoffnung von damals, dass sich die Parteienlandschaft bald konsolidieren würde, haben sich nicht bewahrheitet. Wer hinter den Kleinparteien und Listen steht, weiß man in den meisten Fällen gar nicht.
Rund die Hälfte der Wählerschaft weiß Umfragen zu Folge nicht, für wen sie stimmen wird – oder ob sie überhaupt wählen geht. Immerhin haben sich rund 70 Prozent der Wahlberechtigten bei der ISIE, der unabhängigen Wahlbehörde, registrieren lassen.
Farah Hached, Leiterin der NGO Labo’ Démocratique (Demokratielabor), ist ebenfalls noch unschlüssig: „Ich fühle mich keiner Partei nahe. Ich habe meine Meinung, meine Vision, wie Tunesien aussehen sollte, aber in der gegenwärtigen politischen Landschaft finde ich mich in keinem der Vorschläge wieder.“ Der Enkelin von Farhat Hached, Gründer des wichtigen tunesischen Gewerkschaftsbunds UGTT, geht es vor allem um Aufarbeitung der Diktaturzeit und Reformen in den Bereichen Sicherheit und Justiz. Was nur Schritt für Schritt geht, auch hier braucht die Bevölkerung Geduld. Denn Tunesien muss derzeit den Spagat schaffen: für die Opfer von Alis Regime, die auf baldige Entschädigungen und Gerechtigkeit drängen, genauso dazu zu sein wie für jene Menschen, die mehr Sicherheit und Stabilität fordern.
Und wie umgehen mit den VertreterInnen des alten Regimes? Die Entwicklung anderer Länder habe gezeigt, dass man sie nicht einfach ausschließen könne, sagt Regierungschef Jomaâ. „Wir müssen sie wieder einbinden, aber auf der Basis neuer Gesetze und neuer Normen.“
Hached fürchtet unterdessen die Rückkehr der Diktatur: „Das war immer eine Bedrohung, von Anfang an“, so Hached. „So lange wir kein stabiles demokratisches System aufgebaut haben, wird sie weiter bestehen.“
Stichwort Sicherheit: Hached warnt davor, dass das Thema in Tunesien als Rechtfertigung dienen kann, die Gesetze zu verschärfen. Und das könne ein erster Schritt Richtung Diktatur sein.
Als bei einem Angriff radikaler Islamisten auf das Militär am Chaambi-Berg mitten im Fastenmonat Ramadan fünfzehn Soldaten getötet wurden, rief Regierungschef Jomaâ nicht nur die Bevölkerung zur Einigkeit auf, er bezeichnete auch jede Kritik an Polizei und Militär als jenseits der roten Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Radikale Fernseh- und Radio-Sender sowie Moscheen wurden kurzerhand und ohne Gerichtsbeschluss geschlossen. Wasser auf die Mühlen derjenigen, die davor warnen, dass auch in Tunesien, wo sich vieles zum Positiven hin entwickelt, der Kampf um einen demokratischen Staat noch lange nicht gewonnen ist.
* Name von der Redaktion geändert.
Sarah Mersch lebt als freie Korrespondentin in Tunesien.
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.