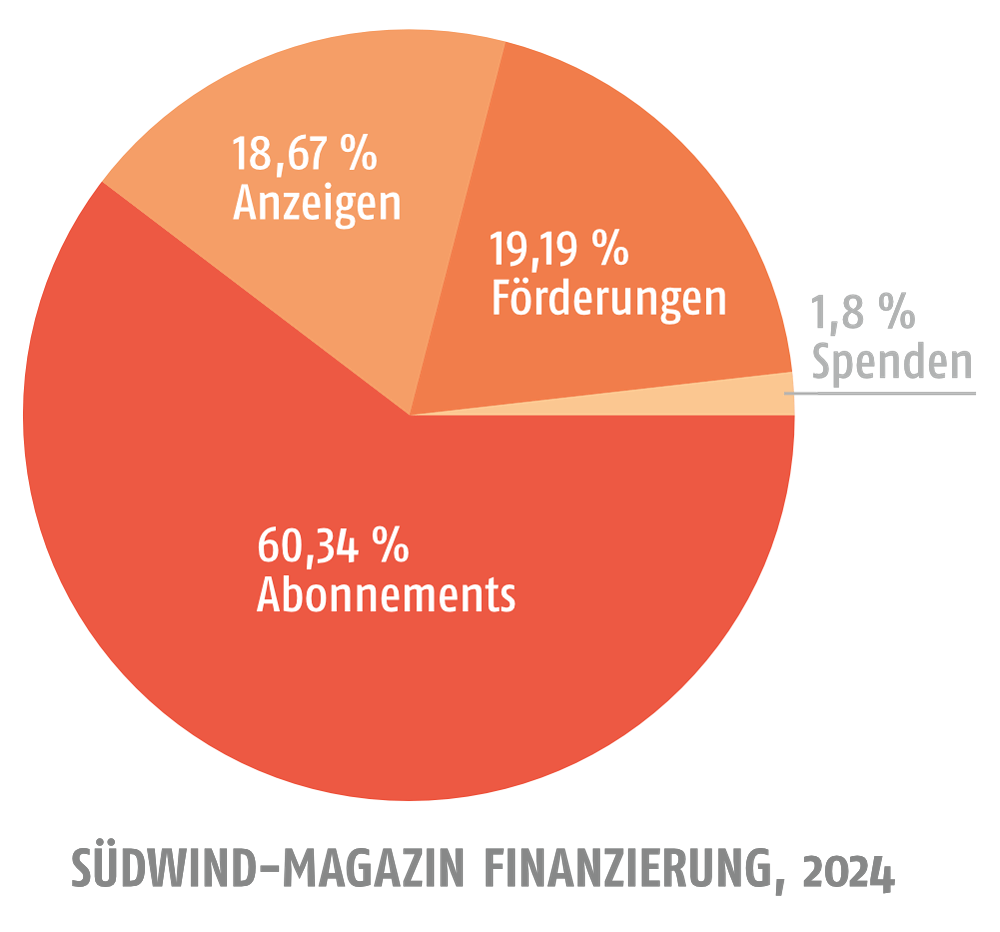Politische Hilfe
Wen oder was sollen die Blauhelmsoldaten der UNO schützen? Insbesondere die Einsätze in Afrika zeigen eine wachsende Kluft zwischen militärischen und politischen Aktivitäten der Vereinten Nationen. Die UNO ringt um neue Konzepte für ihre Friedenseinsätze.
Die Bilanz ist ernüchternd. So steht die UN-Blauhelmmission in Sierra Leone, die größte der Welt, vor dem Zusammenbruch, seit der zweitgrößte Truppenentsender Indien Mitte September den Abzug seines Kontingents ankündigte. Der Grund: Der Militärkommandant der UN-Truppe, der indische General Vijay Jetley, hat sich irreparabel mit Nigeria zerstritten, das den politischen Leiter der Mission und das größte UN-Truppenkontingent in Sierra Leone stellt. Der Inder warf den Nigerianern vor, seine Arbeit zu hintertreiben, um ihre eigene Rolle zu stärken. Nigeria verlangte empört den Abzug des Generals – nun gehen die Inder alle zusammen.
Dies schwächte die UNO in Sierra Leone zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Der Sicherheitsrat schafft es derzeit nicht einmal , die von UN-Generalsekretär Kofi Annan gewünschte Vergrößerung der Blauhelmtruppe von derzeit maximal 13.000 Mann auf maximal 20.500 zu beschließen. Denn die großen anglophonen Militärmächte der Welt, die USA und Großbritannien, sind nicht bereit, eigene Soldaten nach Sierra Leone unter UN-Kommando zu entsenden. Dabei hat Großbritannien sehr wohl 400 Mann in und um das Bürgerkriegsland unter eigener Regie stationiert.
Die Zurückhaltung der Nato-Länder könnte sogar dazu führen, dass der drittwichtigste Truppenentsender Jordanien dem indischen Beispiel folgt und die UN-Mission verlässt. Diese wäre dann vermutlich handlungsunfähig – außer wenn sie faktisch zurück in nigerianische Hände gelegt wird.
Das hehre Ideal, das UN-Friedenseinsätzen zugrundeliegt – das harmonische Zusammenwirken von Soldaten unterschiedlicher Nationalitäten zur Realisierung eines Ziels jenseits nationaler Interessen – erweist sich in Afrika ein um das andere Mal als nicht durchsetzbar. Missionen, die sich noch daran halten, wie die UN-Beobachtermission in der Demokratischen Republik Kongo, fristen ein Schattendasein, von den Akteuren vor Ort kaum wahrgenommen und ohne praktischen Einfluss auf die Ereignisse.
Nur solche internationalen Einsätze, in denen die UN-Flagge dann in der Nachfolge eines vorherigen nationalen Kampfeinsatzes gehisst werden kann, versprechen Erfolg: zum Beispiel die kurzlebige UN-Mission in der Zentralafrikanischen Republik 1998-99, die das Land im Windschatten einer vom Tschad angeführten regionalen Militärintervention vor dem Zurückgleiten in den Bürgerkrieg bewahrte.
Multinationale UN-Truppen operieren mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, und dieser muss möglichst schon vorher definiert und den lokalen politischen Kräften klargemacht worden sein. Militärisch verspricht ein UN-Eingreifen am meisten Erfolg dann, wenn es nicht um die Gesamtlösung eines verworrenen politisch-militärischen Konflikts geht, sondern um ein begrenztes, klar umrissenes und von den internen Konfliktpartnern anerkanntes Ziel. Zum Beispiel die Überwachung der Waffenstillstandslinie zwischen Äthiopien und Eritrea, die Sicherung von Wahllokalen in der Zentralafrikanischen Republik, Entminung in Mosambik, vielleicht auch demnächst in Sierra Leone oder Kongo militärischer Schutz für limitierte humanitäre Aktionen oder geographisch klar eingegrenzte Wiederaufbauprojekte.
In der Diskussion um Sinn und Unsinn von UN-Aktionen in afrikanischen Konflikten ist dies in dem Maße wieder in den Vordergrund gerückt, in dem sich die Durchsetzung von Friedensabkommen als kurzfristig unrealisierbar erweist. Besonders deutlich wird dies derzeit in der Demokratischen Republik Kongo.
Die in- und ausländischen Kriegsparteien scheren sich nicht im geringsten um das Friedensabkommen, das sie im Juli 1999 in Sambias Hauptstadt Lusaka unterzeichneten. Immer wieder brechen neue Kämpfe aus, die Zahl der Kriegsvertriebenen steigt ständig, die Lage der Bevölkerung wird immer verzweifelter. Aber äußere Hilfe gibt es so gut wie keine, weil alle internationalen Eingreifmaßnahmen bis hin zu einer UN-Truppenstationierung bislang die Einhaltung des Lusaka-Abkommens zur Vorbedingung machen.
Mit der Selbstverpflichtung zur Untätigkeit macht sich die Welt faktisch zur Geisel der Warlords; währenddessen sterben die Menschen im Kongo zu Tausenden an Seuchen, Hunger und den Folgen von Flucht.
Erst jetzt setzt in Teilen der humanitären Organisationen und des UN-Apparates ein Umdenken ein, um humanitäre Sofortmaßnahmen auch ohne die vorherige Erfüllung politischer Bedingungen zu ermöglichen. Dass das funktionieren kann, bewies die landesweite Polio-Impfkampagne des UN-Kinderhilfswerks UNICEF und der UN-Weltgesundheitsorganisation WHO gemmeinsam mit Partnern wie Rotary International und anderen gemeinnützigen Organisationen, die in den letzten Monaten unbürokratisch und pragmatisch trotz Kriegswirren 96 Prozent der betroffenen Kinder des Kongo erreichte.
Eine Entpolitisierung von Hilfe wäre der umgekehrte Weg von dem, den die UNO und andere große Organisationen seit Mitte der 90-er Jahre aufgrund ihres Scheiterns in Somalia, Ruanda und Angola eingeschlagen hatten. Damals hatte man gelernt, dass internationale humanitäre Hilfe nicht unpolitisch sein kann, dass sie immer politische Folgen hat und daher am besten schon innerhalb eines klar formulierten politischen Ziels geleistet werden sollte, dessen Umsetzung realistischerweise wiederum zumindest die Drohung mit militärischer Schlagkraft beinhalten muss.
Mangels dieser Schlagkraft, aber auch mangels klarer politischer Ziele setzt nun wieder eine Rückbesinnung auf die eigentlichen humanitären Prioritäten ein.
Um aber die früheren Fehler nicht zu wiederholen, muss es jetzt darum gehen, nicht erneut auf die großen, schwerfälligen und überteuerten internationalen Hilfswerke zu setzen, sondern auf lokale zivilgesellschaftliche Kräfte. Sie brauchen in den meisten Konfliktgebieten einfach ein wenig militärische und finanzielle Sicherheit, um konkrete Arbeit zu leisten, die der Bevölkerung tatsächlich zugutekommt. Die Rolle der UNO wäre dabei, die lokalen zivilgesellschaftlichen Gruppen politisch gegenüber Kriegsparteien zu vertreten und auch zu schützen.
Diese Überlegungen stecken noch in der Anfangsphase, sind aber Erfolg versprechender als so manches, was zur Zeit aus dem UN-Generalsekretariat zu hören ist. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung der UN-Friedenssicherungsabteilung (DPKO).
Die von Kofi Annan immer wieder betonte Notwendigkeit, aus dieser derzeit kaum arbeitsfähigen Abteilung eine schlagkräftige Aktionszentrale zu machen, ist angesichts des Debakels der UNO in vielen Konfliktherden sicher verständlich. Die gewünschten konkreten Auswirkungen davon sind aber relativ vage formuliert.
Kofi Annan schlägt beispielsweise in seinem jüngsten Bericht zu Sierra Leone vor, die Maximalstärke der Blauhelmtruppe nicht nur auf 20.500 Mann zu erhöhen, sondern um noch einmal sechs Bataillone mehr, also um ein weiteres Drittel. Dies sei notwendig, falls die UNO in die von Rebellen kontrollierten Diamantenfördergebiete im Osten des Landes vorstoßen solle. Warum aber die größte militärische Anstrengung der Vereinten Nationen weltweit im Schutz westafrikanischer Diamantenfundstellen bestehen soll und inwieweit dies zum Frieden in der Region beiträgt, geht daraus nicht hervor.
So zeichnet sich eine wachsende Kluft zwischen den zivilen und den militärischen Aktivitäten der UNO in Afrika ab. Dies hat zum Teil paradoxe Konsequenzen. Die meisten UN-Blauhelmsoldaten in Afrika sind Afrikaner. Für die meisten davon sind UN-Missionen das erste nach internationalen Standards professionalisierte Umfeld und zudem eines, in dem sie als Ausführende eines UN-Mandats eine explizite politische Rolle einnehmen. So führen die UN-Friedenssicherungsaktivitäten in Afrika zur Stärkung und Politisierung der afrikanischen Armeen.
Es ist kein Zufall, dass bei den meisten Militärrevolten und Putschen Afrikas der letzten Jahre ehemalige Blauhelmsoldaten eine führende Rolle eingenommen haben. Für die Beseitigung der Folgen eventuell daraus entstehender Konflikte sind ja dann andere UN-Abteilungen zuständig.
Dominic Johnson ist Afrika-Ressortleiter der Berliner Tageszeitung „taz“.