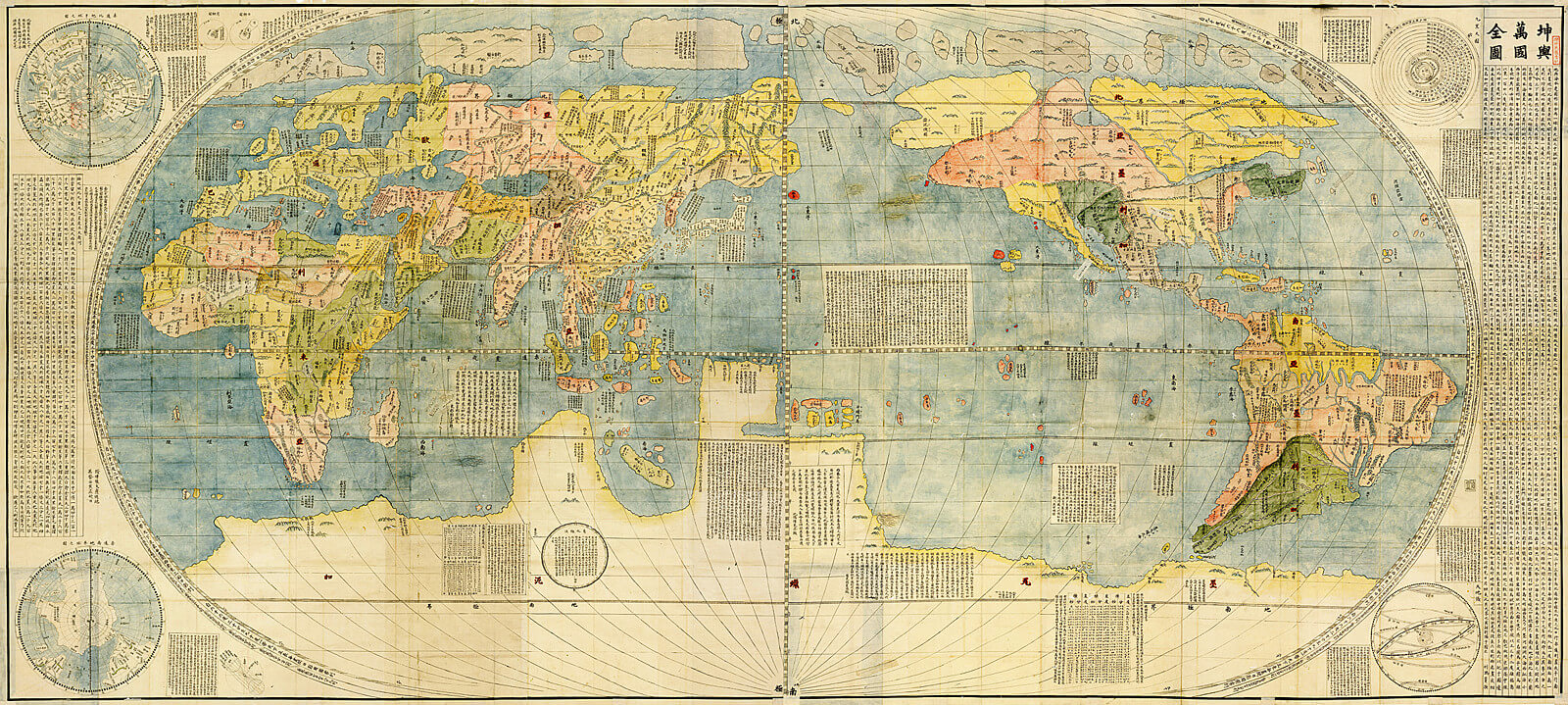
Ein lukratives Geschäft
Weltweit machen sich private Anbieter im Bildungssystem breit. Warum Gewinnstreben dort nichts verloren hat und das Erreichte verteidigt werden sollte, erklärt New Internationalist-Autorin Hazel Healy.
In den vergangenen Jahren war eine rasche Zunahme der Aktivitäten des Privatsektors im Bildungsbereich zu verzeichnen. Die AkteurInnen sind unterschiedlich, doch ihre Versprechen sind dieselben: Effizienz, Wahlfreiheit und Wettbewerb, gestützt auf die angebliche Unfähigkeit öffentlicher Bildungssysteme, ein bedarfsgerechtes, qualitätsvolles Angebot bereitzustellen. Privatisierung ist das Mittel der Wahl, um diese Ziele zu erreichen. Mit der weltweiten Zunahme der Einschulungsraten und einem enormen ungedeckten Bildungsbedarf steht das Thema hoch oben auf der politischen Agenda: die Fundamente einer qualitativ hochwertigen, öffentlichen Schulbildung wackeln, doch noch nie war es wichtiger, sie zu verteidigen.
Die Erscheinungsformen der laufenden neoliberal inspirierten Transformation des Bildungssystems sind vielfältig. Oft werden sie öffentlich nicht beachtet, etwa die Modelle einer privatisierten Schulbildung wie die unabhängigen „Charter Schools“ in den USA und Neuseeland oder die „Friskolor“ (freie Schulen) in Schweden. Australien wiederum hat sein nationales Bewertungsprogramm an den britischen Medienkonzern Pearson ausgelagert – das größte Bildungsunternehmen der Welt mit einem Umsatz von mehr als fünf Mrd. US-Dollar (2016).
Überall im globalen Süden, in Ländern wie Kenia, den Philippinen oder Ghana, expandieren Privatschulketten, die Schulbildung zum Billigtarif vermarkten. Auch in öffentlichen Schulen ist mit Angeboten wie Digitalem Lernen, Datenverwaltung oder beruflicher Weiterbildung eine schleichende Invasion des Privatsektors zu beobachten.
In Großbritannien manifestiert sich der Trend in Gestalt der so genannten „Academies“– Schulen mit gemeinnützigen Trägerinstitutionen, die zwar staatlich finanziert werden, aber mehr Autonomie als ihre öffentlichen Gegenstücke genießen: Sie legen selbst fest, was sie ihrem Personal bezahlen, wen sie aufnehmen und welche Managementpraktiken sie anwenden.
In England wurden seit 2010 mehr als die Hälfte der Sekundarschulen und fast ein Viertel aller Grundschulen in „Academies“ umgewandelt. Wie der britische Fernsehsender Channel 4 herausfand, werden einige von Stiftungen betrieben, die sich überhöhte Gehälter, kostspielige Zulagen und großzügige Verträge mit Unternehmen leisten, die ihren Verwaltungsratsmitgliedern gehören – alles auf Staatskosten.
Weniger spricht dagegen dafür, dass die „Academies“ die versprochene Alternative für jene sind, die im öffentlichen System Probleme haben. Ganz im Gegenteil: Ob „Academies“ oder „freie Schulen“, sie fördern die Segregation und lassen die Schwächeren im Stich.
„Im Academy-Modell liegt es ja nahe, sich genauer anzusehen, wen man aufnimmt“, meint Rachel Crouch, eine ehemalige Schuldirektorin, die sich dagegen gewehrt hatte, ihre Grundschule in Oxford in eine „Academy“ zu verwandeln. „Sie müssen nachweisen, dass sie einen besseren Unterricht liefern, wenn sie ihre Gehälter rechtfertigen wollen. Daher werden natürlich einige Academies keine Kinder mit speziellen Bedürfnissen aufnehmen. Sie sind bloß auf Ergebnisse aus – und das wird wichtiger als das einzelne Kind.“
Hauptsache Testen. Die technische Entwicklung hat den TestfanatikerInnen Rückenwind verschafft. Heute sind enorme Mengen an Vergleichsdaten verfügbar, und LehrerInnen und Schulleitungen werden heute auf eine Weise für die Lernerfolge ihrer SchülerInnen verantwortlich gemacht, die nicht nur neuartig, sondern auch beunruhigend ist. Der Trend ist kein Zufall – er entspricht der neoliberalen Auffassung von Bildung als Ware. Das „Produkt“ muss gemessen und verglichen werden, und daher auch jene, die dieses Produkt bereitstellen.
Sind gute Ergebnisse in standardisierten Tests das Um und Auf, wird oft geschwindelt. In Atlanta sorgten rigorose privatwirtschaftliche Managementmethoden scheinbar für spektakuläre Verbesserungen, bis sich herausstellte, dass sich alles den Manipulationen von mehr als 180 Lehrkräften verdankte, die Angst um ihre Jobs hatten.
Quantität vor Qualität. „Eine ganze Branche befasst sich nur damit, die Evaluierung des Unterrichts zu verbessern und Leuten ein Ranking und Bewertungen zu verpassen“, konstatiert David Archer von ActionAid, einer Entwicklungs-NGO mit Sitz in Johannesburg, Südafrika. Dahinter steht auch eine ökonomische Logik, wie das Beispiel von Pearson zeigt: Das Unternehmen verlegt Schulbücher, stellt Prüfungskommissionen bereit und investiert in Privatschulketten in Entwicklungsländern.
„Je eher Pearson argumentieren kann, dass Lernen überall auf dieselbe Weise erfolgt, egal, wo man sich befindet, desto eher können sie Bücher und Prüfungen standardisieren, die Stückpreise senken und mehr Gewinn machen“, gibt Archer zu bedenken.
Dabei spricht nichts dafür, dass eine bessere standardisierte Bewertung zu einer höheren Qualität des Lernens führen wird. „Man sagt ja, dass das Schwein vom Wiegen nicht fett wird. Und mit welchen Methoden wird das überhaupt erreicht? Man könnte Kinder foltern oder drillen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, aber das ist keine qualitätsvolle Schulbildung. Sollten wir nicht die Persönlichkeitsentwicklung insgesamt fördern?“
Billig und profitabel. Der Trend zur Privatisierung und Standardisierung ist nicht nur in reichen Ländern zu beobachten. Im Süden haben private Anbieter heute im Grundschulbereich einen Anteil von 13 Prozent, gemessen an der Zahl der SchülerInnen (5Prozent in den reichen Ländern), und sogar von 25 Prozent im Sekundarschulbereich.

Schulen, die nicht von öffentlichen Trägern, sondern etwa von Glaubensgemeinschaften oder gemeinnützigen Organisationen betrieben werden, gab es seit jeher. Nun aber gibt es einen neuen Typ: Privatschulen speziell für Kinder aus armen Familien. Seit 2014 verzeichnen diese kostengünstigen, gewinnorientierten Schulen ein exponentielles Wachstum – etwa die des US-Unternehmens Bridge International Academies mit mehr als 500 Schulen und rund 100.000 SchülerInnen in Kenia, Uganda, Liberia, Nigeria und Indien. Das extrem standardisierte, skalierbare Modell von Bridge setzt auf Lehrkräfte, die mittels E-Book-Reader nach einem in den USA erstellten Drehbuch Unterricht erteilen.
Bridge behauptet, um 30 Prozent billiger zu sein als öffentliche Anbieter; für 2025 wird mit einem Umsatz von 750 Millionen Dollar gerechnet.
Die Omega Schools in Ghana, ein Unternehmen des britischen Universitätsprofessors und Unternehmers James Tooley, setzen auf ähnliche Konzepte: die Unterrichtseinheiten sind standardisiert, als Lehrkräfte werden High-School-AbsolventInnen beschäftigt. Die Schulgebühren sind täglich zu bezahlen, wozu die Kinder ein Wertkarten-Armband tragen: Ist es aufgeladen, dürfen sie rein.
Privat vs. Öffentlich
Firmen und Investoren drängen weltweit in den Sektor Bildung. Der „Markt“ ist schätzungsweise 4,4 Billionen US-Dollar wert.
Privatschulanteil an der Primärbildung
Reiche Länder: 5%
Entwicklungsländer: 13%
2013 waren in Indien 40% aller Primar- und SekundarschülerInnen in Privatschulen eingeschrieben. Schätzungsweise wird der Anteil auf 55 – 60% im Jahr 2022 steigen.
In Pakistan betrug 2013 der Anteil der Privatschulen 34%.
In Nigeria, Kenia und Ghana wächst der Anteil der Privatschulen rasant.
Quelle: Global Campaign for Education
„Können wir die Schulerziehung derart aufs Spiel setzen?“, fragt Delphine Dorsi, Menschenrechtsanwältin und Koordinatorin der Right to Education Initiative, einer internationalen NGO. „Was Kinder in der Schule lernen, ist so wichtig für sie, für die Gesellschaft. Wenn sie den Unterricht versäumen, wie werden sie das aufholen? Können wir Schüler wie zahlende Kunden behandeln, als ob das ein Geschäft wie jedes andere wäre?“
Selbst Schulen mit niedrigen Gebühren erzeugen – wie alle Privatschulen – Segregation, so das Ergebnis der meisten Studien. Ihre Zielgruppe ist die arme Bevölkerung, aber nicht die Ärmsten. Dadurch bewirken sie eine „Stratifizierung auf der Mesoebene“ so Frank Adamson von der Stanford University. Bisher konnte auch nicht zweifelsfrei gezeigt werden, dass der Unterricht in diesen Schulen qualitativ besser ist als in öffentlichen Schulen, wenn man die Lernerfolge der SchülerInnern um ihren sozioökonomischen Hintergrund bereinigt.
Ebenso unbewiesen ist die Behauptung, dass diese Schulen Kinder erreichen, die sonst keinen Zugang zu Schulbildung hätten. Die meisten Kinder, die keine Schule besuchen, leben in ländlichen Gebieten, und dort gibt es kaum Privatschulen dieses Typs.
Zivilgesellschaftliche Organisationen haben immer wieder vor einer unkontrollierten Ausbreitung privater Schulmodelle gewarnt, und auch mehrere UN-Menschenrechtsinstitutionen haben sich klar dagegen ausgesprochen. Doch rund 264 Millionen Kinder und Jugendliche besuchen nach wie vor keine Schule, und die Qualität der Schulbildung lässt zu wünschen übrig (siehe Beitrag auf Seite 34) . Vor diesem Hintergrund hat sich der Privatsektor auf dem World Education Forum und auf ähnlichen Konferenzen erfolgreich als mögliche Lösung verkauft: Geber wie Großbritannien, die USA, die Niederlande und die Weltbank sind der Verführung erlegen. Sie haben Millionen in Bridge und andere private Anbieter investiert.
Verbesserungspotenzial. Zweifellos sind viele öffentliche Schulen in einem beklagenswerten Zustand, vor allem in einigen armen Ländern, deren Bildungssysteme unter chronischem Geldmangel leiden, sei es wegen generell leerer Staatskassen, mangelnder Entwicklungshilfe oder Korruption.
„Die Regierungen haben große Probleme“, stimmt Dorsi zu. „Hier besteht unbedingt Handlungsbedarf. Aber man sollte dabei nicht das Recht auf Bildung untergraben. Das ist kein Problem der Ideologie. Es geht nicht darum, dass öffentlich besser als privat wäre. Vielmehr sollten alle Zugang zu qualitativ hochwertiger Schulbildung haben, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Muttersprache oder ihres Einkommens. Dazu haben sich alle Staaten verpflichtet.“
„Würde Bridge in Gebiete gehen, wo es keine Schulen gibt, würde ich mich mehr dafür interessieren“, sagt Lucy Maina, Programmdirektorin des Africa Educational Trust (AET), der in einigen der ärmsten, entlegensten Regionen der Erde arbeitet. Etwa in Dol Dol im Nordosten Kenias, wo AET Grundschulen unterstützt und ein Bildungsprogramm für Massai-Frauen unterhält.

Die Ärmsten erreichen. „Hier und in anderen Teilen Kenias, das ist wie Tag und Nacht“, betont Maina. „In diesen ärmeren Gegenden ist alles schwer erreichbar, alles schwer zu bekommen.“ Von Dol Dol bis zur nächsten größeren Stadt sind es 80 Kilometer über schlechte Straßen. Hier gibt es kein Internet und eine hohe Analphabetenrate, aber dafür häufige Dürreperioden, Viehdiebstahl, Praktiken wie die Verstümmelung der weiblichen Genitalien, Kinderehen und wilde Büffel und Elefanten auf dem Schulweg. LehrerInnen halten es hier oft nicht lange aus. Und wenn Kinder in der Schule nicht gerade erfolgreich sind, sehen Eltern oft auch keinen Grund, sie dorthin zu schicken anstatt sie das Vieh hüten zu lassen.
Innerhalb von drei Jahren schaffte es AET, einen Umschwung herbeizuführen. Zuerst wurde dafür gesorgt, dass die Massai-Kinder in ihrer eigenen Sprache unterrichtet werden – was den Unterrichtserfolg generell verbessert hat. Dann konzentrierte sich AET darauf, den Müttern Grundkenntnisse in Rechnen, Lesen und Schreiben zu vermitteln. „Man muss den Unterricht dort abhalten, wo sich die Frauen befinden, denn sie haben viele Arbeiten zu erledigen“, sagt Maina. Frauen bringen oft Behälter mit, um nach dem Unterricht Wasser zu holen, eine Axt, um Feuerholz für das Abendessen zu hacken, und auch Großeltern, um auf die Babys aufzupassen.
Lern-Begeisterung. Rund 400 Frauen können nun rechnen, lesen und ihren Namen schreiben. Auf individueller Ebene bedeutet das einen großen Unterschied – sie können Geldsendungen erhalten und Überweisungen vornehmen, und eine der Frauen ist nun Wahlbeamtin und beteiligte sich zuletzt erstmals an einer Wahl. Das hat auch Auswirkungen auf die rund 2.000 Schulkinder: „Sie konkurrieren mit ihren eigenen Kindern und lernen von ihnen“, schildert Maina.
Die nun lese- und schreibkundigen Eltern haben sich zudem darüber informiert, wie viele Lehrkräfte es per Gesetz in ihrer Gegend geben sollte, und die kenianische Regierung dazu gebracht, 19 neue, zweisprachige LehrerInnen aus der lokalen Bevölkerung einzustellen. „Nun erleben sie, wie ihre eigenen Leute wieder zurückkommen und ihnen helfen. Es herrscht viel Begeisterung rund um das Lernen“, freut sich Maina. Die Testergebnisse verbessern sich, und immer weniger Kinder brechen die Schule ab.
Aufwertung der LehrerInnen. „Die Weltbank redet von Absentismus und macht die Lehrer dafür verantwortlich. Aber das ist ein Symptom der Vernachlässigung“, betont Rene Raya von der Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) in Manila. „Die Lehrer sind die Opfer eines geschwächten Bildungssektors – sie bekommen wenig bezahlt, niemand kümmert sich darum, wie es ihnen geht, und von Weiterbildung ist keine Rede. Sie sind demoralisiert und machtlos.“
ASPBAE ist eine von 5.000 Mitgliedsorganisationen des einflussreichen Netzwerks Global Campaign for Education, das in 87 Ländern vertreten ist. Eine bloß geringfügige Intervention einer NGO – ein zweiwöchiger Kurs zu den Themen Sprache und soziale Bewusstheit – hätte einen Motivationsschub bei den LehrerInnen ausgelöst, erzählt Raya: „Danach arbeiteten sie hart für ihre Schüler, bemühten sich, sie zurück in die Schule zu bringen.“
Die NGO krempelte die Schulleitung um, sorgte dafür, dass die lokale Bevölkerung mitreden konnte und gab der neuen Direktion freie Hand in Finanzierungsfragen. Eltern erklärten sich bereit, SchülerInnen mit Problemen Nachhilfeunterricht zu erteilen. Mit den Verbesserungen meldeten andere Eltern ihre Kinder, die sie zuvor in Privatschulen geschickt hatten, wieder an der öffentlichen Schule an. „Tatsächlich braucht man keine Milliarden Dollar, um die öffentliche Schulen zu verbessern“, bilanziert Raya. „Was es braucht, ist Anerkennung und ein Mitspracherecht.“
Kritisches Denken. Wenn eine Schule Qualität haben will, dann muss sie auch die Fähigkeit zu kritischem Denken vermitteln – davon ist jedenfalls Aamna Pasha aus Karachi überzeugt. „Wir stellen generell zu wenige Dinge in Frage“, versichert Pasha. Sie bildet Lehrkräfte aus, die in ärmeren Regionen Pakistans die kognitiven Fähigkeiten von 11- bis 14-Jährigen fördern sollen. „Ich will, dass Kinder in der Lage sind, ein Problem zu analysieren und über eine mögliche Lösung nachzudenken“, betont sie, und „dass sie wissen, dass es auch andere Meinungen geben kann, andere Perspektiven.“
Die LehrerInnen arbeiten in Klassen mit 5 bis 60 SchülerInnen. Pasha vermittelt ihnen, wie sie nicht bloß klassisch unterrichten, sondern die kreative Gruppenarbeit der Kinder unterstützen können. Entscheidend dabei ist, dass sie den Lehrstoff an die unterschiedlichen Wirklichkeiten der Kinder anpasst. Geht es etwa um gefährdete Tierarten, befassen sich Kinder in Karachi mit den Flussdelfinen im Indus; in Gilgit, im gebirgigen Norden, mit der Schraubenziege (Markhor). In Gilgit besuchten und interviewten die Kinder sogar einen Jäger, wobei sie für die Markhor eintraten und ihm alternative Berufstätigkeiten vorschlugen. „Die Kinder hatten damit überhaupt kein Problem“, erzählt Pasha lachend, „die Lehrer haben etwas länger gebraucht.“
Dass die Kinder mehr Selbstvertrauen gewinnen und mehr Engagement im Unterricht zeigen, ist nur einer der Effekte. Die SchülerInnen einer von einer NGO betriebenen Schule in einer Fischergemeinschaft, die seit drei Jahren an dem Programm von Pasha teilnahm, bestanden eben die Abschlussprüfung der neunten Schulstufe mit Bestnoten. Drei Jahre zuvor war der gesamte Jahrgang durchgefallen.
Zurück nach Oxfordshire, wo Rachel Crouch vom „Philosophieren mit Kindern“ (P4C) schwärmt, bei dem Kinder im Grundschulalter über ethische Probleme nachdenken, etwa wann Stehlen gerechtfertigt sein könnte, und sich mit Werten wie Ehrlichkeit und Freundschaft auseinandersetzen.
„Die Schulen mit P4C sorgen für ein höheres Kompetenzniveau“, versichert Crouch. „Die Kinder können sich besser ausdrücken, sie lernen, wie man diskutiert. Wenn sie nach der Schule in die Arbeitswelt eintreten, dann müssen sie das können – das ist ihre Zukunft.“ Sie ist überzeugt, dass die bisher besten Ergebnisse ihrer Schule bei den letzten landesweiten Tests für Elfjährige („SATs“) davon Zeugnis ablegen.
Chancengerechte Bildung. Zugang für alle, ein offenes Curriculum, partizipativer Unterricht, motivierte Lehrkräfte – das klingt nicht besonders kompliziert, und es wirkt sich positiv aus. Schulsysteme in Finnland, Teilen Kanadas oder Kuba, wo die öffentliche Trägerschaft unumstritten ist, erzielen in internationalen PISA-Tests langfristig konsistent bessere Ergebnisse als die marktorientierten Systeme in Schweden, den USA oder Chile. In Finnlands höchst erfolgreichem öffentlichen Bildungssystem wird auf ständige, das Vertrauen zerstörende Vergleichstest völlig verzichtet. 10 bis 15% der Arbeitszeit der LehrerInnen sind der Weiterbildung gewidmet, alle verfügen über einen höheren Studienabschluss und Schulen können selbst über ihren Lehrplan entscheiden. Es gibt keine Schulinspektionen, doch die finnische Regierung kann Zufallsstichproben von zehn Prozent der Arbeiten der SchülerInnen anfordern. Das Land gibt 30-mal mehr für die Ausbildung des Lehrpersonals aus als für die Bewertung der Leistungen der SchülerInnen und Schulen (in testbasierten Bildungssystemen ist das Verhältnis umgekehrt).
Chancengerechtigkeit wird in Finnland großgeschrieben. Der Schulerfolg soll nicht vom familiären oder sonstigen Hintergrund bestimmt sein; in Schulen in benachteiligten Gegenden wird daher auch weit mehr investiert.
Letzlich ist es kein großes Rätsel, was man für ein solides öffentliches Bildungssystem benötigt: Geld für Investitionen und gut ausgebildete Lehrkräfte. In den reichen Ländern sollte das leicht zu schaffen sein. Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen bräuchten jedoch zusammen jedes Jahr 39 Mrd. US-Dollar mehr, um Kindern eine Schulbildung hoher Qualität zu ermöglichen. In Ländern mit niedrigem Einkommen fehlen sogar mehr als 40 Prozent der nötigen Mittel.
Steuern statt Hilfe. Ein Teil der Finanzierungslücke sollte durch die Entwicklungshilfe der reichen Länder geschlossen werden – derzeit stellen sie jährlich zwölf Mrd. Dollar zur Verfügung, gerade zweiProzent der US-Rüstungsausgaben von 2016. Eine Aufstockung auf 39 Mrd. Dollar ist jedoch unwahrscheinlich. Die Hilfe für den Bildungsbereich stagniert, und nur ein kleiner Teil davon ist zwischen den Gebern abgestimmt, deckt die richtigen Lücken ab und stimmt mit den Zielen der nationalen Bildungsprogramme überein. Geber sind oft zu erpicht darauf, ihr eigenes „Markenzeichen“ zu hinterlassen und versuchen, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen, kritisiert David Archer von ActionAid.
„Letztlich wird es auf höhere Steuern hinauslaufen“, meint Archer. „Regierungen müssen selbst ausreichende Mittel aufbringen, auf Basis einer fairen, d.h. progressiven Besteuerung, und in das Bildungssystem investieren.“ In Ghana etwa könnte bloß durch eine Streichung der Steueranreize für transnationale Unternehmen das Bildungsbudget verdoppelt werden, in Sierra Leone wäre derart eine Versiebenfachung möglich.
Brasilien hat gezeigt, was mit politischem Willen machbar ist. Der Anteil der Bildungsausgaben am Gesamtbudget wurde zwischen 2000 und 2016 von zehn auf 18 Prozent erhöht. In Kombination mit vom Schulbesuch abhängigen Zuschüssen für Eltern konnte die Zeit, die die Kinder der ärmsten 20 Prozent in der Schule verbringen, von vier auf acht Jahre verdoppelt werden.
Kein Platz für Profit. Bei Entscheidungen über den Inhalt und die Methoden des Unterrichts sowie über die Organisation von Schulen darf das Gewinnstreben keine Rolle spielen. Wir brauchen ein Bildungssystem, das mit dem Ziel einer höheren Qualität für alle investiert sowie gut ausgebildete Lehrkräfte, Lehrpläne, die an den jeweiligen Lebenswirklichkeiten ansetzen, sowie Unterstützung für inklusives und progressives Lernen bereitstellt. Nichts davon ist schwierig. All das wird auch rund um die Welt praktisch umgesetzt. Aber wir müssen für diese Ziele kämpfen und entschlossen verteidigen, was bereits erreicht wurde.
Copyright New Internationalist
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.

